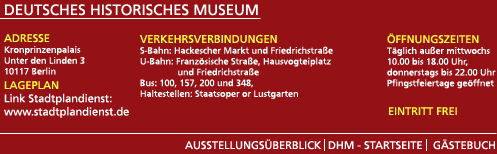|
Von der besonderen Alchimie, aus Menschenblut Gold zu
machen, oder von den Möglichkeiten, Hexereiverdacht und Hexenprozesse
zu instrumentalisieren Schon der Trierer Stiftskanoniker Johann Linden († nach 1627), der eindringlich die schrecklichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der exzessiven Hexenverfolgungen im Trierer Land geschildert hat, versuchte dieses Phänomen mit zwei sich keineswegs widersprechenden Ursachen zu erklären. Hexenprozesse wurden nach seiner Meinung entweder aus hysterischer Hexenangst oder aber aus pragmatisch-eigennützigem Interesse geführt: Das einfache Volk habe aus schierer Angst vor dem verderblichen Treiben der Hexen und aufgrund der leidvollen Erfahrung mehrerer schlechter Erntejahre die an Lynchjustiz erinnernden Hexenjagden angezettelt. Die kurfürstlichen Beamten dagegen, die Amtleute, Richter, Notare und Henker, hätten aus purer Geldgier und Renommiersucht dem Druck von unten nachgegeben und sich aus dem Besitz der Hingerichteten die Taschen gefüllt. Sie hätten es ausgezeichnet verstanden, auf diese Weise die Asche der unglücklichen Opfer in Gold zu verwandeln. Damit griff Linden ein Argument auf, das bereits Cornelius Loos († 1596), ein in Trier lehrender holländischer Theologe und entschiedener Gegner der Hexenjagden, formuliert hatte und das er neben anderen Thesen 1593 in einem rituellen Unterwerfungsakt widerrufen musste. Nach Loos sei auf der Folterbank das Blut unschuldiger Menschen vergossen und durch eine neue Alchimie aus Menschenblut, Gold und Silber gemacht worden. Wenn der Kanoniker Linden sich im Gegensatz zu Loos auch nicht zu einer grundsätzlichen Kritik am Hexenglauben durchringen konnte, so gab er doch zu, dass viele Unschuldige eben wegen der unkontrollierten Menschenjagd der Bauern und der ebenso wenig gezähmten Profitgier der Gerichtsbeamten den Feuertod gefunden hatten. Auch der Gerichtsschöffe Hermann Löher († 1678), der nur durch Flucht im Jahre 1638 seiner Hinrichtung im kurkölnischen Rheinbach entgehen konnte, kam in seiner Wehmütigen Klage (Druck 1676) zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: Schuld an den schlimmen Hexenverfolgungen waren neben vorgeblich frommen Gemeindemännern und Ausschussmitgliedern, die bei ihren Hochgerichtsherren aus abergläubischer Dummheit und purer Berechnung auf die Führung von Hexenprozessen drangen, in erster Linie die profitgierigen Richter, Amtleute und Hexenkommissare. Auch andere zeitgenössische Verfolgungsgegner wie Friedrich Spee († 1635) oder Johann Matthäus Meyfarth († 1642) erkannten durchaus eigennützige Motive hinter der unbarmherzigen Hexenjagd. Doch nicht nur in ihren Schriften, in Chroniken oder autobiographischen Berichten finden sich kritische Töne. Selbst in den Prozessakten gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass die Verfolgungsinstanzen - wohl auch im Wissen um eigene, heimliche Beweggründe - damit rechneten, dass Hexereibeschuldigungen nur vorgeschoben sein konnten. So mussten im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin die dörflichen Hexenausschüsse schwören, gegen niemanden aus Hass, Neid oder Rache vorzugehen. Auch die Zeugen waren gehalten, unter Eid zu versichern, nicht aus Missgunst oder Streitsucht gegen die angeklagten Personen auszusagen. Ganz besonders misstrauisch wurden die inquirierenden Beamten gerade dann, wenn die Opfer unter der Folter auch ihre Ankläger und deren Helfershelfer der Mittäterschaft bezichtigten. Hier konnte nach Meinung der auf diese Weise oft selbst in Verdacht geratenen Gerichtspersonen in den meisten Fällen nur pure Rachsucht im Spiel sein! Immer wieder wurden deshalb die Angeklagten genötigt, solche belastenden Aussagen zurückzuziehen. Beim Studium der Hexenprozessakten, die in ihrer konstruierten und selbstbestätigenden Logik die sündhafte Verworfenheit und das hexische Doppelleben der angeblichen Teufelsdiener unzweifelhaft nachzuweisen scheinen, hat man einige Mühe, andere Gründe für die Hexenverfolgung zu finden als jene, die vordergründig und formelhaft sowohl von den lokalen Hexenjägern als auch von den obrigkeitlichen Gerichtsinstanzen immer wieder artikuliert wurden. In Anklageschriften und Urteilsbegründungen wird stereotyp die Angst vor den Hexen und die Furcht vor dem Zorn Gottes beschworen; die Wiederherstellung der göttlichen Ehre, die Befolgung der zehn Gebote und die Wahrung des Gemeinen Nutzens wurden angemahnt und dienten als Rechtfertigung für die gnadenlose Verfolgung der Hexen und Hexenmeister. Reine Worthülsen waren diese Formulierungen sicher nicht, doch ließen sich mit Hexenfurcht, Sorge um das Gemeinwohl und Wahrung der höchsten, göttlichen Autorität offenbar auch andere, durchaus profane Motive verbinden. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man neben den Prozessakten der unteren Gerichte auch die Überlieferung der übergeordneten Gerichtshöfe und Appellationsinstanzen heranzieht, etwa die des Luxemburger Provinzialrates, des Grand Conseil von Mecheln oder des Reichskammergerichts. Obwohl die Möglichkeiten, sich zu wehren, begrenzt waren, gingen bei übergeordneten Instanzen doch erstaunlich viele Supplikationen und Klagen ein, entweder von Personen, die gegen Hexereibeschuldigungen einen Injurienprozess oder nach bereits erfolgter Anklage eine Überprüfung des Verfahrens wegen offenkundiger Rechtsbrüche - meist mit aufschiebender Wirkung - erreichen wollten, oder von solchen, die unter der Folter ungeständig geblieben waren und nun nach ihrer Freilassung die Forderung nach Schadensersatz und Aktenkassation erhoben. Während in den meisten Hexenprozessen die Verdächtigen nur unter dem Druck der Anklage zu Wort kamen, ihre Aussagen durch die Niederschrift eines Notars gefiltert und durch Verhör und Folter verzerrt nur noch in eine Richtung, nämlich die Bestätigung des Hexereiverdachtes, gehen konnten, wurden vor den Appellationsinstanzen nicht selten aus den Angeklagten Kläger. Obwohl auch hier der Originalwortlaut gewöhnlich durch einen Notar in eine gerichtsrelevante Sprache transformiert worden ist, so lässt der Inhalt dieser Aussagen bei aller vorsichtigen Interpretation doch kaum Zweifel daran, dass Menschen nicht selten bewusst in Hexereiverdacht gebracht wurden, wobei weniger die Ehre Gottes oder der Gemeine Nutzen eine Rolle spielten als vielmehr Machtstreben, Habgier, Bestechlichkeit, Neid und Rachsucht. Sicher konnte sich die Hexenfurcht auf dem Land und manchmal auch in den Städten zu panikartigen, geradezu massenhysterischen Aktionen gegen angebliche Hexen und Hexenmeister steigern. Und natürlich zweifelten im 16. und 17. Jahrhundert nur wenige grundsätzlich an der Existenz der Teufelsdiener. Doch den Zeitgenossen war durchaus bekannt, dass sich der Verdacht nicht immer gegen die tatsächlichen, die ‚wahren Hexen' richtete, sondern dass auch Unschuldige - absichtlich oder unabsichtlich - belangt wurden. Das Etikett, eine Hexe oder ein Hexenmeister zu sein, wurde ähnlich wie der Vorwurf der Ketzerei angehängt und zugeschrieben. Diese komplexen Vorgänge, bei denen das soziale Umfeld mit seinen paradoxen Mechanismen von üblem Gerücht und aggressiv-handgreiflicher Kommunikation darüber entschied, wer verdächtigt wurde und wer nicht, ließen alle Möglichkeiten zu, Prozesse aus eigennützigen Motiven zu nutzen. So war es auch für Menschen, die tief im Teufels-, Hexen- und Wunderglauben ihrer Zeit verstrickt waren, durchaus möglich, Hexereiverdacht zu steuern und Hexenprozesse zu funktionalisieren und zu instrumentalisieren. Dieses Phänomen lässt sich auf allen Ebenen der Verfolgung, in jedem Stadium des Prozesses und bei allen beteiligten Gruppen feststellen: Während die Familie und die Nachbarschaft den Hexereiverdacht zur Lösung sozialer Konflikte einsetzten, gewannen die lokalen Hexenjäger, die Ausschuss- und Monopolmitglieder ebenso wie die beteiligten Schöffen, Gerichtsbeamten, Richter und Notare nachweislich wirtschaftliche und soziale Vorteile aus ihrer Arbeit. Auch Hochgerichts- und Landesherren konnten aus der Hexenverfolgung einen spezifischen Nutzen ziehen. Selbst die Verfasser dämonologischer Traktate hatten mit ihren angeblich ‚aufklärerischen' Schriften über das unheilvolle Treiben der Hexen nicht nur uneigennützig deren Ausmerzung im Sinn. In den Dorfgemeinschaften, wo der Hexereiverdacht immer auf fruchtbaren Boden fiel, lassen sich die Nutzungs-Mechanismen gut erkennen. Die genossenschaftlich organisierte Feld- und Flurarbeit sowie die von verschiedenen Instanzen (Sendgericht, Niedergerichtsbarkeit) eingeübte Rüge- und Denunziationspflicht erforderte ein hohes Maß an Absprache und sozialer Kontrolle in den ländlichen Gemeinden. Dieses Netz war dicht gewebt, jeder beobachtete jeden, und leicht konnten aus nachbarschaftlicher Aufmerksamkeit Bespitzelung, üble Nachrede und Verleumdung werden. Auch der Hexereiverdacht bot in diesem Kontext die Möglichkeit, unliebsame Zeitgenossen zu diffamieren und letztendlich zu vernichten. Übereinstimmend zeigen die Akten der lothringischen, luxemburgischen, kurtrierischen und saarländischen Hexenprozesse, wie in den Dorf- und Kleinstadtgemeinden die Hexen ‚gemacht' wurden. Traditionelle soziale Bindungen zerbrachen, Nachbarschaft und Verwandtschaft boten kaum noch Sicherheit. Sogar innerhalb der Familien kam es häufig zum Streit zwischen den Ehepartnern; man beschimpfte sich gegenseitig als Hexe und Hexenmeister und rechnete sich die inzwischen schon hingerichteten jeweiligen Familienmitglieder vor. Man kann nachweisen, dass einige Ehemänner ihre Ehefrauen absichtlich in Verdacht brachten und sie als angebliche Hexen bei den lokalen Verfolgern denunzierten. Auch eingeheiratete Schwiegertöchter und Stiefmütter hatten nicht selten einen schweren Stand in ihrem neuen Zuhause und wurden schon bei den geringsten Auseinandersetzungen als Hexen diffamiert. Dabei wirkte sich immer wieder eine wirtschaftlich prekäre Situation aus, ging es in den Streitereien doch nicht selten um eine angeblich verschleuderte Mitgift, um den Diebstahl von Bettwäsche, Kleidern und Hausrat, um Wohnrechte, um die richtige Verteilung des Nachlasses. Die hohe Sterblichkeit, zu der auch die Hexenverfolgung ihren Teil beitrug, ließ die Wiederverheiratungsrate ansteigen. Die Zahl der Stief- und Waisenkinder wuchs, schwer durchschaubare Verwandtschafts- und daraus resultierende Erbschaftsverhältnisse waren die Folge. Nicht selten kam es aus diesem Anlass zu Streitigkeiten zwischen den Kindern, die später wiederum in Hexereiverdacht und Hexenprozess enden konnten. Die Situation musste sich darüber hinaus zuspitzen, wenn die Begleichung der Prozesskosten aus dem nachgelassenen Erbe der Hingerichteten anstand, das die Hinterbliebenen oft nur unter Preis verkaufen konnten. War einmal ein Mitglied der Familie als Hexe oder Hexenmeister hingerichtet worden, fiel der Verdacht schnell auf die verbliebenen Angehörigen. Solidarität, Mitgefühl oder gar Hilfestellung für angeklagte Familienmitglieder, Ehepartner oder Kinder findet man nur selten. Bereitwillig dienten dagegen die nächsten Verwandten als Zeugen der Anklage gegen ihre verdächtigten Familienmitglieder. Schon aus Selbstschutz blieb angesichts der monströsen Bedrohung, als Nächster der Hexerei verdächtigt zu werden, kaum eine andere Wahl, als sich möglichst rasch von seinen diffamierten Angehörigen zu distanzieren. Ganz nebenbei waren auf diese Weise auch Vorteile zu gewinnen, konnte man doch mittels des Hexereiverdachts seinen ungeliebten Ehepartner loswerden oder aber die Eltern vom Hof vertreiben. Immer wieder begegnen in den Akten Fälle, wonach die Nachbarin etwas Mehl, Butter oder Most erbeten hatte oder der Nachbar ein Werkzeug oder ein Gespann ausleihen wollte. Doch in Zeiten allgemeiner Not wurden die Vorräte knapper, man achtete eifersüchtig auf sein Eigentum und solidarische Hilfe wurde häufig verweigert. Der enttäuschte Bittsteller reagierte in den meisten Fällen mit manchmal gemurmelten, manchmal lautstarken Beschimpfungen und Flüchen. Der insgeheim mit einem schlechten Gewissen belastete, weil wenig mildtätige Nachbar, führte jedes folgende Missgeschick auf eben diese Verwünschungen zurück und verdächtigte den Abgewiesenen der Hexerei. Ein ähnlicher Mechanismus trat in Kraft, wenn ausgeliehene Gegenstände nicht oder beschädigt zurückgegeben, wenn Geldschulden zu spät und gar nicht beglichen wurden. Das Konfliktpotential zwischen den Dorfgenossen stieg ebenfalls erheblich, wenn es Streit um knappe Lehr- und Arbeitsstellen, um falsche Eheversprechungen, ausgespannte Bräutigame und gelöste Verlöbnisse ging. Auch hier waren Verdächtigungen und Hexereibezichtigungen an der Tagesordnung. Ein Ausdruck dieser latent missgünstigen und streitsüchtigen Stimmung war die Häufigkeit, mit der auch Angehörige der Nachbarschaft bereitwillig als Zeugen der Anklage dienten. Ohne Zweifel wurde auch in diesem Kontext der Hexereiverdacht genutzt, um soziale Konflikte auszutragen, alte Streitigkeiten zu lösen, Neid und Missgunst freien Lauf zu lassen. Während Verfolgungsgegner wie Spee oder Meyfarth bereits scharfsinnig diese Motive erkannten, glaubte der Hexenhasser Jean Bodin († 1596), dass niemand besser gegen vermeintliche Hexen aussagen könne als die Nachbarn, die ja am besten über den Lebenswandel der Verdächtigen informiert seien. Hexenprozesse, die gegen Geistliche angestrengt wurden, resultierten auch nicht selten aus dem Versuch der Gemeindekinder, einen im Konkubinat lebenden Pfarrer, der überdies seine Aufgaben als Seelenhirte nur schlecht versah und neben einem skandalösen Lebenswandel auch noch andere Betrügereien beging, los zu werden. Genügende Beispiele für diese Form der Nutzung von Hexenprozessen gibt es in der Eifel, in Luxemburg und auch im Trierer Land. Den Hexenausschüssen und Monopolen stand bei ihrer ‚Arbeit' ebenfalls ein hohes Nutzungs- und Instrumentalisierungspotential zur Verfügung. So erwartete diejenigen Männer, die von der Gemeinde als Hexenausschuss oder Monopolmitglied aufgestellt worden waren, ein erheblicher Zuwachs an sozialem Prestige. Zwar schworen zum Beispiel die in St. Maximin zugelassenen Ausschüsse einen heiligen Eid, ausschließlich zur Ausrottung des abscheulichen Zaubereilasters, zur Mehrung der Ehre Gottes sowie des Gemeinen Nutzens tätig zu werden. Außerdem sollten sie niemanden ohne ausreichend belastendes Material anzeigen oder seinen Leumund schädigen. Die von der Obrigkeit erhaltenen Informationen durften Dritten gegenüber nicht bekannt gemacht, die auflaufenden Prozesskosten sollten so gering wie möglich gehalten werden. Die Norm der in den Eidesformeln festgelegten Pflichten stand jedoch in krassem Gegensatz zum tatsächlichen Vorgehen der Hexenjäger. Sie achteten nicht auf Diskretion, auf den zu schützenden Ruf potentieller Opfer; vielmehr spielte sich das Aufspüren von so genannten Beweisen und Zeugen vor aller Augen ab. Schnell war bekannt, gegen wen sich die Jagd dieses Mal richtete. Misstrauen, Bespitzelung und Verleumdung wurden angestachelt. Die Ausschussmitglieder legten selbst Register von vermeintlich verdächtigen Personen an, die über lange Jahre aufbewahrt und in der Familie weitergegeben wurden. Hier ließen sich nach dem Abflauen einer Hexenjagd neue ‚Indizien' finden, um wieder gegen die angeblich ‚bösen Leute' vorgehen zu können. Die Hexenjäger reisten außerdem von Hinrichtung zu Hinrichtung auch in fremde Hochgerichtsbezirke, um die dort öffentlich verlesenen Komplizenlisten mitzuschreiben, ja, sie trafen sich auch mit den Hexenausschüssen anderer Orte, um Informationen auszutauschen. Gezielt streuten sie ihr auf diese Weise erlangtes Wissen um Bezichtigungen und belastende Gerüchte in ihren Heimatgemeinden aus. Kein Wunder, dass die ins Gerede gebrachten Personen wie ein Magnet weitere Verdächtigungen an sich zogen. Das Ausmaß dieser Wühlarbeit wird gerade aus den Akten des Luxemburger Provinzialrates deutlich. Eindringlich schildern ehemalige Opfer, wie sie von den Monopolen, den Klagekonsortien absichtlich in Verdacht gebracht worden waren. Immer wieder wird dabei den Monopolmitgliedern persönliche Rachsucht und Vorteilnahme unterstellt. Doch nicht nur die Kläger selbst, ihre gesamte Familie gehörte oft mehr oder weniger offen zum Monopol: Während die Männer als klagende Partei auftraten und die Indizien zusammentrugen, fungierten andere Familienmitglieder, meist die Ehefrauen, als Zeugen der Anklage. Außerdem dienten sich viele Gemeindemitglieder den Ausschüssen und Monopolen als Zuträger und Denunzianten an, nicht selten lieferten die nächsten Angehörigen sogar die entscheidenden Hinweise. Mit ihrer Anhängerschaft konnten die lokalen Hexenjäger eine nicht zu unterschätzende Machtposition, ja, eine Art heimliche Regierung im Dorf oder in der Kleinstadt ausüben. Offenbar stammten sie aus dem Kreis jüngerer, aufstrebender Familien, die versuchten, die älteren Führungsfamilien auch mit Hilfe der Hexenprozesse zu verdrängen. Außerdem brachte die Tätigkeit als Ausschuss- oder Monopolmitglied handfesten wirtschaftlichen Nutzen. Nicht zufällig tagten die Anklagegremien bevorzugt in Wirtshäusern, wo sie auf Kosten der Angeklagten ausgiebig tafelten. In Zeiten allgemeiner Not stellte dies allein schon eine nicht zu unterschätzende Vorteilnahme dar. Es gibt ausreichend Belege dafür, dass Personen mit gefährdetem Ruf offenbar versuchten, die Sammlung von Indizien durch heimliche Bestechung der Hexenjäger abzuwenden. Außerdem erhoben die Ausschüsse und Monopole in manchen Gemeinden eine ‚Hexensteuer', mit deren Hilfe sie ihre Ausgaben abdecken wollten. Es war nicht ratsam, sich den Steuereinnehmern zu widersetzen, geriet man doch bei Zahlungsverweigerung sofort in den Verdacht, ein Hexensympathisant, wenn nicht gar selbst Mitglied der Hexensekte zu sein. Mit dem eingenommenen Geld gingen die Hexenjäger jedoch alles andere als sorgfältig um; oft genug verwandten sie es zur Begleichung ihrer hohen Wirtshausrechnungen und drangsalierten dann die Gemeinde mit neuen Geldforderungen. Daneben wurde von wohlhabenden Angeklagten immer wieder der Vorwurf erhoben, man habe sie ganz bewusst als nächstes Opfer ausgewählt, um mit ihrem Geld die noch ausstehenden Kosten der weniger einträglichen Prozesse zu decken. Die Praxis solcher Amortisationsgeschäfte lässt sich in Luxemburg, aber auch in kurtrierischen Kondominien nachweisen. Dieser Umstand hing mit der Prozessfinanzierung zusammen; denn nach den Vorschriften des akkusatorischen Verfahrens mussten der oder die Privatkläger die Aufstellung der Anklageschrift, die Beibringung der Zeugen und Indizien (Besagungen, Denunziationen) vorfinanzieren. Erstattet wurden diese Auslagen entweder über die Prozesskostenrechnung, so in Kurtrier und in St. Maximin, oder aber aus dem konfiszierten Gut, wie in Lothringen und Luxemburg. Unbeglichene Ausgaben, bei ärmeren Hingerichteten nicht gerade selten, wurden kurzerhand den wohlhabenden Angeklagten auf die Rechnung geschrieben. Wenn man bedenkt, welches Terrorregime manche Ausschüsse und Monopole in ihren Dörfern und Kleinstädten errichteten, dann bleibt schwer verständlich, warum man diese Gremien aufstellte und so lange agieren ließ. Zu berücksichtigen bleibt, dass die Ausschüsse gewöhnlich nicht die gesamte Einwohnerschaft einer Siedlung repräsentierten, sondern lediglich diejenige Partei, die sich in der Gemeindeversammlung hatte durchsetzen können. An solchen Versammlungen nahmen ausschließlich die über Eigentum und Herdstelle verfügenden Männer einer Gemeinde teil. Außerdem scheint die Konstituierung der Ausschüsse meist in einer tumultuarischen, mit indifferenten Ängsten hochgepeitschten Situation stattgefunden zu haben, in der eine panikartige Hexenfurcht vorherrschte und in der es nicht geraten schien, zur Mäßigung aufzurufen. Die wenigen Personen, die Widerstand gegen die Ausschussbildung geleistet haben, sind ohne Ausnahme auf dem Scheiterhaufen geendet. Da im Herzogtum Lothringen Monopole und Anklagekonsortien konsequent verboten waren und man auch die heimliche Finanzierung von Privatklägern durch andere Geldgeber zu verhindern wusste, traten Auswüchse, wie sie in Luxemburg, Kurtrier, St. Maximin und im Saarraum zu fassen sind, nicht auf. Schon den Zeitgenossen waren die weitgespannten Nutzungsmöglichkeiten auf Seiten der Schreiber, Notare, Prozessgutachter, Schöffen, Richter, Amtleute und Hexenkommissare bekannt. Übereinstimmend wurde ihnen von allen Verfolgungsgegnern die Hauptschuld an der massenhaften Ausbreitung der Hexenprozesse zugeschrieben. Mit der Führung von Hexenprozessen konnte man tatsächlich Prestige erwerben, den sozialen Status steigern, die Karriere begünstigen und - nicht zuletzt - Profit erwirtschaften. Der berüchtigte Amtmann Britt aus der Herrschaft Elter (Autel) ließ sich bei der Versteigerung von konfisziertem Gut durch Strohmänner vertreten, manipulierte die Veranstaltung und erwarb auf diese Weise zu niedrigsten Preisen Liegenschaften, Vieh und Hausrat. Nachweislich kaufte der Trierer Dompropst Hugo Cratz von Scharfenstein († 1625) den Nachkommen von Hingerichteten Wiesen und Grundstücke an der Mosel ab, die diese wahrscheinlich zu Dumping-Preisen abgeben mussten. Ebenso verlockend waren die Aussichten für einige Hochgerichtsherren, mit Hilfe von Hexenprozessen eigene Interessen durchzusetzen. Am deutlichsten wird die herrschaftlich-politische Instrumentalisierung an den im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin geführten Hexenprozessen. Hier befand sich der Abt Reiner Biewer († nach 1613) in ständiger Auseinandersetzung mit Kurtrier um die Reichsunmittelbarkeit seiner Herrschaft. Der Nachweis des souveränen Besitzes von Blut- und Hochgerichtsbarkeit als oberstem landeshoheitlichem Recht ließ sich durch massenhaft geführte Hexenprozesse problemlos und unangreifbar erbringen, war es doch erste und von den Dämonologen immer wieder eingeforderte Pflicht der Obrigkeit - und einer geistlichen Obrigkeit im Besonderen - das Laster der Zauberei streng zu bekämpfen. Für die fatal effiziente Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Amtleuten und Obrigkeit in St. Maximin sprechen nicht nur die hohen Hinrichtungszahlen. Auch die gute Aktenüberlieferung ist nicht zuletzt als Folge des ungeheuren Bürokratisierungsschubs, den die vorgeschriebene schriftliche Niederlegung der Prozesse auslöste, zu erklären. Die Hexenprozessakten wurden hier nicht zufällig überliefert, sondern wohl in der Absicht, sie beim Streit um landesherrliche Autonomie vorlegen zu können, sorgfältig abgeschrieben und archiviert. Auch die vielen vom Maximiner Amtmann Claudius Musiel († circa 1609) initiierten und in der St. Maximiner Kanzlei angefertigten Register, Verzeichnisse und Auflistungen zeigen, wie weit hier die Dokumentation der Hexenverfolgung zum Zweck der Herrschaftslegitimierung getrieben wurde. Ganz ohne Zweifel dienten im Gebiet der Reichsabtei St. Maximin die Hexenprozesse vielen Zwecken; dass der Abt von Hexenangst erfüllt war, spielte sicher eine Rolle, aber wichtiger waren sie für ihn wohl als Mittel der Herrschaftssicherung. Wie die Akten beweisen, ließen sich außerdem damit aufsässige Pächter und betrügerische grundherrliche Beamte disziplinieren. Ähnliche Mechanismen lassen sich auch in den Gutsherrschaften Mecklenburgs feststellen. In der kleinen Eifelherrschaft Wildenburg wurde der Streit um die Hochgerichtsrechte fast ausschließlich über die Führung von Hexenprozessen ausgetragen. Marsilius von Palandt († 1669), einer der Herrschaftsinhaber und vom Jülicher Herzog belehnt, ließ gegen den offenen Widerstand des Grafen zu Salm-Reifferscheid, welcher die Hochgerichtsrechte in Wildenburg für sich reklamierte, 1628 eine Hinrichtungsstätte mit mehreren Verbrennungshütten aufbauen, eine ganze Mannschaft von Henkern und Bütteln anheuern und mehrere Männer und Frauen wegen angeblicher Zauberei hinrichten. Eindeutig versuchte er mit dieser öffentlich demonstrierten Blutgerichtsbarkeit, den schon länger schwelenden Streit zu entscheiden. Wie sehr eine Obrigkeit ihren Herrschaftsanspruch mit der Hexenjagd fast unanfechtbar legitimieren konnte, zeigt schließlich der Umstand, dass der Graf von Salm-Reifferscheid zwar gegen die Errichtung der Galgen beim Reichskammergericht klagte, dort aber betonte, er selbst habe in seiner Herrschaft bereits zuvor Hexen hinrichten lassen. Ohne Zweifel wollte er nicht in den Geruch kommen, die ‚übeltäterischen Hexen' zu beschützen. Auch in den vielen kleinen und kleinsten Adels- und Klosterherrschaften, die der Luxemburger Landeshoheit unterstanden oder lehnsrechtlich an das Herzogtum gebunden waren, wurden Hexereiverfahren von den um Eigenständigkeit bemühten Hochgerichtsherren nicht zuletzt deshalb geduldet und gefördert, weil man sich damit gegen kontrollierende Eingriffe der übergeordneten Luxemburger Provinzialregierung wehren wollte. Es gibt Hinweise darauf, dass bei einem Herrschaftswechsel der neue Herr als erstes Hexenprozesse durchführen ließ, um seine Ansprüche allen sichtbar zu demonstrieren. Auf der einen Seite boten die Hexenprozesse den lokalen Hochgerichtsherren eine Möglichkeit, sich demonstrativ gegen einen steigenden allumfassenden staatlichen Zugriff zu wehren, bewiesen die vielen in eigener Regie geführten Verfahren doch unabhängige Gerichtskompetenzen und gewahrte alte Rechte. Auf der anderen Seite waren die landesfürstlichen Obrigkeiten beim Ausbau frühmoderner Staatlichkeit daran interessiert, alle hoheitlichen Funktionen zu bündeln und noch selbständige Herrschaften zu abhängigen Untergerichten zu degradieren. Dies bedeutete unter anderem, die Kontrolle über die herrschaftslegitimierende Blutgerichtsbarkeit und damit auch über die Führung von Hexenprozessen zu gewinnen. In der Praxis hieß dies: allmähliches Zurückdrängen der Gewohnheitsrechte, Durchsetzung einer einheitlichen, auf dem römischen Recht fußenden Jurisdiktion, Zwang zum Instanzenzug und Kontrolle der lokalen Gerichte durch Oberhöfe, Supplikations- und Appellationsinstanzen, und nicht zuletzt auch die Ablösung der lokalen, ungelehrten Schöffenkollegien durch ausgebildete Juristen und Notare. Damit diente die Kontrolle der Hexereiverfahren auch der herrschaftlichen Raumerfassung und der Durchsetzung landeshoheitlicher Machtansprüche. Diese Entwicklung lässt sich im Herzogtum Luxemburg nachweisen. Hier versuchte der Provinzialrat über einen längeren Zeitraum hinweg, mit einer Fülle von Ordonnanzen, den Einfluss der Hochgerichte und ihrer ungelehrten Schöffen in den kleinen Adels- und Klosterherrschaften zurückzudrängen, indem er die Prozessführung bei jedem neuen Schritt von dem verbindlichen Rechtsgutachten eines zugelassenen und kontrollierten Notars abhängig machte. Langfristig gelang es tatsächlich, die hochgerichtlichen Befugnisse der ‚kleinen' Herrschaften auszuhöhlen und ihre Kompetenzen kontinuierlich einzuschränken. Im Herzogtum Lothringen ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen, hier wurde ebenfalls konsequent versucht, die Hexenprozesse auf Dauer unter die Aufsicht des herzoglichen Oberhofs in Nancy und unter Leitung eines herzoglichen Prokurators (zum Beispiel Nicolas und Claude Remy) zu stellen. Auf staatlicher Seite konnten die landeshoheitlichen Regierungen, je nachdem welches besondere Interesse sie mit der Führung beziehungsweise Kontrolle von Hexenprozessen verbanden, die Verfolgungen auf der einen Seite begünstigen, um sie auf der anderen Seite zu erschweren. So unterstützte der Herzog Wolfgang Wilhelm von Jülich-Berg († 1653) seinen Lehnsmann Palandt 1628 bei dessen Streit um die Hochgerichtsrechte und ließ die Hexenverbrennungen von Jülicher Soldaten bewachen. Gleichwohl erließ er aber 1631 den Befehl, dass die dem Herzogtum unterstehenden oder angebundenen Partikular- und Unterherrschaften nur mehr nach Einholung von Rechtsgutachten bei der herzoglichen Kanzlei und unter dessen Aufsicht Hexenprozesse führen durften. Damit band er die eigenständigen und lokalen Gerichtsinstanzen stärker an die Zentralverwaltung, ähnlich wie es die landesherrlichen Regierungen in Luxemburg und Lothringen versuchten. Der sich als Reichsfürst und Landesherr verstehende Abt von St. Maximin scheint diese Methode, Kontrolle über die Hexenprozesse zu gewinnen, durchschaut zu haben. Zwar wurden auch in St. Maximin die Prozessakten streng nach der Carolina an einen Oberhof zur Begutachtung geschickt, aber dieses Gremium tagte in einem Haus nahe der Abtei auf deren Hoheitsgebiet. Damit wurde der Trierer Oberhof als gutachtende Behörde nicht in die St. Maximiner Verfahren involviert und somit hatte der Kurfürst keine Möglichkeit, den Instanzenzug als Beweis für seinen eigenen Hoheitsanspruch auf St. Maximin zu nutzen. Außerdem konnte er formalrechtlich die auf die Carolina gestützten Maximiner Hexenprozesse in keiner Weise als illegal anfechten und diesen möglichen Vorwurf als Begründung für einen gewaltsamen oder militärischen Eingriff in das Maximiner Territorium benutzen. Schließlich konnten die Hexenprozesse auch den Verfassern von gelehrten Traktaten in vielfältiger Weise dienen. Der aus armen Verhältnissen stammende Trierer Weihbischof Peter Binsfeld hätte ohne seine fanatisierende Schrift gegen die Hexen sicher weniger Aufmerksamkeit in der Gelehrtenwelt seiner Zeit gewonnen. Wäre Binsfeld nicht 1598 an der Pest gestorben, hätte sein Einfluss, den er wohl durch Anschwärzung des ihm in der Hexenverfolgung etwas zu nachlässigen Erzbischofs beim päpstlichen Stuhl in Rom noch auszudehnen gedachte, sicher noch zugenommen. Auch seine Karriere innerhalb der kirchlichen Hierarchie hätte dann vielleicht noch eine Stufe weiter nach oben geführt. Auch anderen Verfassern von dämonologisch-juristischen Traktaten wie zum Beispiel Nicolas Remy († 1612), Henri Bouget († 1619), Pierre de Lancre († circa 1630) oder Heinrich von Schultheiß († 1646) mag es noch um etwas anderes als um die uneigennützige Warnung vor den ‚bösen Leuten' gegangen sein. Immerhin konnten mit diesem ‚Modethema' hohe Auflagen und ein breiter Leserkreis nicht nur in der Gelehrtenwelt erreicht werden. Offensichtlich besaßen sowohl Hexereiverdacht als auch die Führung von Hexenprozessen eine verhängnisvolle Ambivalenz. So war die Verfolgung der Hexen mit der höchsten nur denkbaren Legitimation ausgestattet; denn sie geschah zur Abwehr der Feinde Gottes, zur Rettung der göttlichen Ehre und zur Sicherung des Gemeinen Nutzens. Mit dieser Begründung konnte jede Obrigkeit, jeder Hochgerichtsherr, jedes Ausschussmitglied, jeder Dorfgenosse sein Vorgehen gegen vermeintliche Hexen rechtfertigen. Schlechtes Gewissen, Skrupel oder Mitleid waren in diesem Kampf nicht angebracht, ja sie verboten sich angesichts der immer wieder heraufbeschworenen existentiellen Bedrohung von selbst. Jeder, der gegen dieses gedankliche Konstrukt, gegen diese Ideologie opponierte, ‚entlarvte' sich praktisch selbst als Komplize der im Geheimen agierenden, schadensstiftenden und todbringenden Hexensekte. Außerdem konnte mit dem Verdacht der Hexerei nahezu jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht, Alter, Stand oder Beruf diffamiert werden. Die Möglichkeit, eigene Interessen wie Neid, Habgier und Rachsucht unter dem Deckmantel der Hexereibezichtigung und dem Ruf nach Hexenverfolgung zu verbergen, war schon den kritischen Zeitgenossen bekannt. Ob die Mechanismen der Funktionalisierung und Instrumentalisierung den Nutznießern der Hexenjagd immer bewusst waren, mag man bezweifeln können. Jedoch wird mancher, der seine Ehefrau bei der Obrigkeit angezeigt hat, sein schlechtes Gewissen wohl mit dem Gedanken beruhigt haben, eine wahre ‚Hexe' auf den Scheiterhaufen gebracht zu haben. Im Bereich der politisch-herrschaftlichen Instrumentalisierung von Ketzer- und Zaubereiprozessen kann man auf eine lange Tradition zurückblicken. Selbst die Zeitgenossen werden Zweifel daran gehabt haben, ob der französische König die Katharer Südfrankreichs allein aus religiösem Eifer vernichten ließ, ob der Prozess gegen die Templer wirklich nur wegen ihrer angeblich ketzerischen und sodomitischen Praxis geführt wurde, ob Jeanne d'Arc tatsächlich eine Teufelsdienerin gewesen ist. Vor diesem Hintergrund erhalten die Hexenprozesse, die gegen den ehemaligen Trierer Stadtschultheißen Dr. Dietrich Flade († 1589), gegen den wohlhabenden Bitburger Schöffen Johann Schweistal (bis 1609) oder gegen den Manderscheider Amtmann Heinrich von Mühlheim († 1629) geführt wurden, besondere Brisanz. Doch spielten die Instrumentalisierungsmechanismen nicht nur bei diesen spektakulären Verfahren eine Rolle. Bei genauem Hinsehen scheinen auch bei vielen Prozessen gegen einfache Frauen und Männer die ‚hehren' Ziele der Verfolgungsinstanzen und ihrer Helfer lediglich vorgeschoben gewesen zu sein.
|
|
|
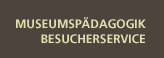 |