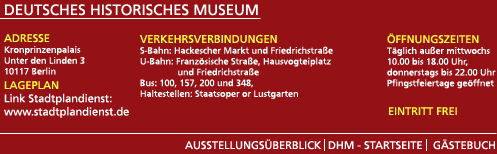|
Das Ende der Hexenverfolgungen in Lothringen, Kurtrier
und Luxemburg im 17. Jahrhundert Wie in anderen Gebieten Mitteleuropas, in denen seit dem 15. und vor allem seit dem Ende des 16. Jahrhunderts Personen aufgrund des Hexereidelikts verfolgt worden waren, kam es auch im Herzogtum Luxemburg, im Herzogtum Lothringen und im Kurfürstentum Trier, allesamt Kerngebiete der Zauberei- und Hexereiverfolgung, vor oder um die Mitte des 17. Jahrhunderts zu einer Abnahme und schließlich zu einer völligen Einstellung der Führung von Hexenprozessen. Wie die Entstehung der Hexenverfolgungen, so hat auch deren Ende vielschichtige Gründe; der juristische Aspekt ist dabei einer der wichtigsten. Dies ist leicht einzusehen, war die Verfolgung der vermeintlichen Hexen und Hexenmeister über Jahrhunderte hinweg doch mehr und mehr von Verwaltungsstrukturen vereinnahmt worden, die mit Hilfe eines zunehmend formalisierten Rechtssystems die sich herausbildenden Territorialstaaten durchdrangen. So ging die Bestrafung angeblicher gotteslästerlicher und schadenbringender Teufelspaktiererei mit der Zeit aus den Händen der Kirche ganz in die der weltlichen Justiz über, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts den von der Dämonologie entwickelten elaborierten Hexereibegriff als Straftatbestand übernommen hatte. Durch neue Ansichten über den Einsatz der Folter sowie durch die Auffassung der Hexerei als crimen exceptum, als Ausnahmeverbrechen, das exzeptionelle Verfahren legitimierte, verfügte die Justiz über das Instrumentarium zu deren gerichtlicher Verfolgung. Die uns heute so unfassbar erscheinende Annahme, dass Hexerei und Teufelsbund existierten, dass diese oder zumindest deren Auswirkungen feststellbar und daher als Straftat zu ahnden seien, ist auch den Zeitgenossen der Hexenverfolgung nicht durchweg einleuchtend gewesen. Nicht nur gelehrte Theoretiker wie Johann Weyer († 1588), Cornelius Loos († 1596), Adam Tanner († 1632) und Friedrich Spee († 1635) sowie andere erkannten die Inkonsequenzen des dämonologisch-abergläubischen Denksystems - auch die meist ungebildeten Opfer der Prozesse argumentierten, sofern das Verfahren ihnen dafür Raum gab, bisweilen mit gesundem Menschenverstand und brachten dadurch die Justiz in die schwierige Lage, schlüssige Beweise für das Hexereidelikt vorzubringen. Die schon früh einsetzenden Erkenntnisse der Obrigkeit über die offenkundig exzessive und rechtsbrüchige Führung von Hexenprozessen sowie die Schwierigkeit einer ‚Wahrheitsfindung' ohne Folter und eine wachsende Verrechtlichung, die sich in der Kontrolle durch Obergerichte, in der Aktenversendung und in einer regen Gutachtertätigkeit äußerte, höhlte die nie seriös konstruierte Logik des Hexenglaubens allmählich aus. Auf den berüchtigten Hexenhammer, den seit 1487 in zahlreichen Auflagen erschienenen Malleus maleficarum, folgte eine Vielzahl dämonologischer Traktate, die immer auch eine Legitimierung der gerichtlichen Verfolgung des Hexereidelikts beabsichtigten. Am deutlichsten wird diese Verbindung in der Person Jean Bodins († 1596), des französischen Juristen, Staatstheoretikers und Autors der Démonomanie (Von der Teufelsmanie). Trotz der Aufnahme des Zaubereidelikts in frühneuzeitliche Strafrechtsordnungen, wie zum Beispiel in die Carolina von 1532, gelang es nicht, die Hexerei mit dem zunehmend maßgeblichen Instrumentarium des römischen Rechts juristisch fassbar zu machen, und so blieben die Autoren dämonologisch-juristischer Schriften immer nur Vertreter eines Randgebietes, deren persönlicher Eifer in der Sache dem ansonsten nüchternen Denken der Rechtsgelehrten zuwiderlief. Waren die bereits in der mittelalterlichen Rechtsrezeption herausgearbeiteten Verbrechen der Häresie und Gotteslästerung, worunter auch die Zauberei fiel, noch eher an Ausübungsformen und Worten festzumachen, so konnte der frühneuzeitliche Hexenbegriff noch nicht einmal durch inquisitorische Gewissenserforschung sichtbar oder hörbar gemacht werden, da die bloße Denunziation durch angeblich Geschädigte oder Besagung durch vermeintliche Hexen zur Anklageerhebung genügte und es sich, weit stärker als bei der Ketzerei, um einen der jeweiligen Person zugeschriebenen, völlig fiktiven ‚Irrglauben' handelte, dem eine ebenso fiktive Schädigungsabsicht unterstellt wurde. Erst die Folter, meist verbunden mit suggestiver Verhörtechnik, konnte hier die zur Verurteilung nötigen Geständnisse erpressen. Diese einseitige Abhängigkeit der Hexenprozesse von durch die Folter erzwungenen Geständnissen musste über kurz oder lang auffallen und von kritischen Juristen in Frage gestellt werden. Der durch die Verfolgungen entstehende gesellschaftliche Schaden lenkte allmählich das Augenmerk der Obrigkeit auf das Hexenprozesswesen. 1. Lothringen Die Spätphase der lothringischen Hexenverfolgungen zwischen 1580 und 1630 erscheint - ähnlich wie in den benachbarten Territorien Luxemburg und Kurtrier - als eine Zeit intensivster Verfolgungen. Innerhalb dieses Zeitraumes bildet das Jahr 1606 eine Zäsur, da hier die Amtszeit des seit 1591 als procureur général und kraft seines Amtes als ‚Hexenjäger' aktiven Nicolas Remy († 1612) endete, was sich mit gewisser Verzögerung noch vor 1610 in einer deutlichen Abnahme der Hinrichtungen wegen Hexerei bemerkbar machte. Ferner verstarb 1608 der Förderer Remys, Herzog Charles III. Als die Kriegszüge des Dreißigjährigen Krieges dann 1630 das Herzogtum erreichten, gingen die Prozesse in den davon besonders betroffenen Verwaltungsbezirken deutlich zurück. In anderen Gegenden begann, bedingt durch die wirtschaftliche Krisenzeit, 1628 eine neue Verfolgungswelle, die 1632 mit dem Durchzug französischer und kaiserlicher Truppen durch das Herzogtum beendet wurde. Verwüstungen und ein enormer Bevölkerungsverlust erreichten 1635 ihren Höhepunkt. Sie ließen den Menschen offenbar keine Zeit mehr, sich gegenseitig der Hexerei zu bezichtigen; vielerorts waren außerdem die obrigkeitlichen Strukturen zerstört. Völlig beseitigt wurden Hexenangst und Verfolgungsbereitschaft aber nicht. Wenngleich es seit den frühen 1630er Jahren zu keinen größeren Prozessserien mehr kam, sind spätere Hexereiverfahren beispielsweise für die Umgebung von Saint-Dié (bailliage de Bruyères) noch bis 1663, für das Metzer Land bis 1670 und für die bailliage d'Allemagne bis 1679 nachweisbar, die in eine Zeit der allmählichen wirtschaftlichen Erholung und der Bevölkerungszunahme fielen. Das Rechtssystem Lothringens besaß mit den échevins oder dem change de Nancy seit dem frühen 16. Jahrhundert eine Oberinstanz auch in Strafsachen, bei der spätestens seit 1596 (Redigierung der coutumes générales) bei allen strafrechtlichen Verfahren um Avise angefragt werden musste. Neben dem change bestand die Institution des procureur général de Lorraine, dem noch vor dem Schöffengericht die Strafsachen zur Begutachtung vorgelegt werden mussten. In diesen Institutionen zeigt sich die Bestrebung, die Rechtsprechung der Untergerichte zu kontrollieren; im Fall der Hexenprozesse wirkten sie zunächst jedoch kaum mildernd auf die Urteile ein, da in der verfolgungsintensivsten Phase mit dem Generalprokurator Nicolas Remy ein dämonologisch motivierter Jurist federführend war. Trotz der herausgehobenen Stellung des procureur waren aber wohl schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Schöffen von Nancy bemüht, mäßigenden Einfluss auf die Durchführung einzelner Hexereiverfahren zu nehmen. Claude Bourgeois, selbst Mitglied des change, publizierte 1614 einen Recueil du style, der genaue Vorschriften zur Durchführung von Verhör und Folter in Strafsachen und insbesondere in Hexereiprozessen enthielt. Diese Anweisungen machten die Verfahren insofern moderater, als Folterexzesse untersagt wurden und ein genauer Prozessablauf festgelegt war. Der Aufstieg zu einer allgemeinen zentralen Rechtsinstanz gelang den échevins de Nancy im Verlauf des 17. Jahrhunderts jedoch nicht, da die ständige Auseinandersetzung Lothringens mit Frankreich die Entwicklung des Landes spürbar hemmte. Das 1633/37 im französischen Metz geschaffene parlement de Metz übernahm die Kompetenzen der échevins und etablierte sich in der gesamten Zeit der französisch protegierten Interimsherrschaft bis 1661, als im Frieden von Vincennes Charles IV. wieder als Herzog eingesetzt wurde, als oberste Appellationsinstanz. Vom parlement wurden in Hexensachen keine Todesurteile mehr ausgesprochen, und auch die Entscheidungen der échevins mildernd revidiert, beispielsweise durch Ablehnung der Folter oder Verhängung einer Verbannungsstrafe anstelle einer Hinrichtung. 1670 geriet das Herzogtum endgültig unter französische Besatzung, die 1685 die échevins abschaffte. Die französische Herrschaft beendete mit dem königlichen Edikt Louis XIV. vom Juli 1682 auch formal die Hexenverfolgung, indem sie die Kompetenzen der lokalen Gerichte und der Parlamente in dieser Frage stark einschränkte. Man kann davon ausgehen, dass in Lothringen die Einwirkung der Obrigkeit auf die Beendigung der Hexenprozesse nicht ausschlaggebend war - sicher überwogen die äußeren Einflüsse. Dennoch hat die hohe Justiz, mit Ausnahme des procureur Remy, die Hexenverfolgung auch nie besonders gefördert, eine Tendenz, die von dem oktroyierten und am verfolgungskritischen Frankreich orientierten parlement de Metz im 17. Jahrhundert noch verstärkt wurde. Robin Briggs und Eva Labouvie haben darüber hinaus für Lothringen gezeigt, dass auch auf der untersten, nämlich der dörflichen Ebene die Menschen Verteidigungsstrategien oder sogar Widerstand gegen den Hexereivorwurf entwickelten. Die Sichtweise des Volkes veränderte sich im Laufe des 17. Jahrhunderts. Hexereibeschuldigungen wurden weniger stark kriminalisiert und erfüllten schließlich nur noch den Tatbestand der Beleidigung. Dass hier Wechselwirkungen mit einem moderaten oder zeitweilig schwachen Justizapparat eine besondere Rolle spielten, erscheint plausibel. 2. Kurtrier Das Einsetzen der großen Hexenverfolgung im Erzstift Trier fällt in die Regierungszeit des Kurfürsten und Erzbischofs Johanns VII. von Schönenberg († 1599); die meisten Prozesse fanden zwischen 1587 und 1594 statt, ab 1596 wurden sie seltener. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts begann, wohl auch infolge einer gewissen Ermüdung, eine längere Phase relativer Ruhe mit nur gelegentlichen Prozessen, bis 1629/30 eine neue Verfolgungswelle einsetzte, die 1631 durch die Einwirkungen des Dreißigjährigen Krieges abbrach. Bis zur administrativen Beendigung der Hexenprozesse 1652 folgten dann ab 1639 wieder kleinere Verfahrenswellen, allerdings ohne die gegen Ende des 16. Jahrhunderts fassbare Flächendeckung der Verfolgung zu erreichen. Regulierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Eindämmung der Verfahren gab es, ähnlich wie in Luxemburg, bereits zu Zeiten intensivster Verfolgungen. Zu nennen ist hier die am 18. Dezember 1591 erlassene Hexenprozessordnung Kurfürst Johanns VII., die insbesondere gegen die seit Beginn der Verfolgungen überhand nehmenden Verbündnusse - gemeint sind die Hexenausschüsse - vorgehen wollte. Die Ordnung beschreibt Hauptgefahren dieser Verschwörungen auf dörflicher Ebene: allgemeine Unordnung (das heißt Entzug der herrschaftlichen Kontrolle), große finanzielle Belastung der Untertanen und Rechtsbrüche. Als Maßgabe für das rechtliche Vorgehen in Zaubereisachen wird zunächst die Carolina genannt. Das Ausschusswesen wird eingeschränkt und reglementiert. Die Einleitung des Verfahrens von Amts wegen (ex officio) ist bei bestehendem Gerücht ohne vorhandenen Kläger vorgesehen, wird aber in der Ordnung nur knapp ausgeführt. Insgesamt mahnt der Text mehrfach zu vorsichtigem Vorgehen und betont die Wichtigkeit der Indiziensammlung vor der Einleitung eines Prozesses. An vielen Stellen wird außerdem die strikte Geheimhaltungspflicht bezüglich der Besagungen angemahnt - die Ordnung erkannte in der Veröffentlichung der Namen von der Hexerei bezichtigten Personen einen wichtigen Auslöser der wellenartigen Verfolgungen. Zudem regelte sie das Verbot der Wasserprobe, die Verpflichtung zur Aktenversendung an das Obergericht zu Koblenz zwecks Erstellung von Gutachten sowie die genaue Festlegung von Unkostenerstattungen für das Gerichtspersonal. Die Verordnung von 1591 reagierte damit formal sehr scharf auf die Verfolgungen. Aus diesem fortschrittlichen und wahrscheinlich an der Luxemburger Ordnung des gleichen Jahres orientierten Rechtstext spricht neben dem offensichtlichen Bestreben, eine stärkere Kontrolle über die Untertanen zu gewinnen und deren eigene Rechtssatzungen zu brechen, auch die Wahrnehmung einer staatlichen Fürsorgepflicht, die letztlich der Stabilität des gesamten Landes dienen sollte. Eine entsprechende Wirkung zeigte der kurfürstliche Erlass jedoch keineswegs. Die starke gemeindliche Verfassung setzte sich allerorts gegen die schwache Landesherrschaft durch, und Offizialprozesse blieben in Hexensachen die Ausnahme; fast immer verlief der Prozess von der Anklage bis zur Hinrichtung auf der Ebene von lokaler Gerichtsbarkeit (Amtmann, Schultheiß, Schöffen) und dörflicher Gemeinde. Am 2. Februar 1630 wurde unter Philipp Christoph von Sötern († 1652) die Prozessordnung von 1591 erneuert, wobei die Liste der zu berechnenden Gerichtshonorare und Unkosten noch ausführlicher war - offensichtlich hatte man in den Kostenexzessen, die sich aus der Verschwendung und Bereicherung der Ausschussmitglieder ergaben, einen zentralen Beweggrund für die Führung von Hexenprozessen erkannt. Seit 1591 war der obrigkeitliche Regulierungswille in dieser Sache jedoch immer wieder umgangen worden, nicht zuletzt durch die Erfindung neuer Posten auf den Rechnungen. Angesichts der weiterhin auffälligen Missstände bei den Hexenprozessen regte sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts vermehrt Widerstand seitens der Betroffenen, die sich mit Klagen über die Willkür der Ausschüsse an den Koblenzer Oberhof wandten oder gewaltsam gegen die Akteure rechtswidriger Ermittlungen vorgingen. Die höhere Justiz war zudem durch verschiedene Skandale in den eigenen Reihen auf gravierende Missstände im Hexenprozesswesen aufmerksam geworden. Wahrscheinlich kurz nach 1652 erging durch Kurfürst Carl Caspar von der Leyen (1652-1676) eine geheime Anweisung an alle Beamten, keine Prozesse in Zaubereisachen mehr zuzulassen. Dies wurde, da es öffentlich nicht ausgesprochen werden konnte, in der Praxis so umgesetzt, dass die formalrechtlichen Anforderungen, die mit einer Klageerhebung verbunden waren, schrittweise immer höher geschraubt wurden. Aus dem Jahr 1659 ist dann ein Schreiben überliefert, in dem sich der Kurfürst zu seiner Maßnahme äußerte: Er bezeichnete die Hexerei als ein verborgen ... laster; aus dieser Tatsache hätten sich vielfältige Missbräuche und Ungerechtigkeiten ergeben, die ein Verbot der Hexenprozesse nahe legten. Unter Carl Caspar sind dann wohl auch systematisch Prozessakten von der Obrigkeit eingezogen und vernichtet worden, um zu verhindern, dass durch Besagungslisten aus geführten Prozessen mit zeitlicher Verzögerung wieder neue Prozesswellen entstehen konnten. Wie in Kurmainz und Schweden, so ist auch in Kurtrier ein Einfluss von Friedrich Spees 1631 anonym publizierter Cautio Criminalis, seu De processibus contra sagas liber (Mahnung zur Vorsicht im Strafprozess, oder über die Prozesse gegen die Hexen) auf das Ende der Hexenverfolgungen nicht eindeutig nachweisbar. Erst ab 1652 sind Prozesse am kurfürstlichen Oberhof in Koblenz überliefert, in denen die Verteidigung mit Hilfe der Cautio criminalis argumentierte - hier wird allenfalls eine Veränderung des geistigen Klimas greifbar, zu der Spees Argumente natürlich indirekt beigetragen haben können. Ein anderer Grund für den Rückgang der Hexenprozesse, zumindest nach einer intensiven Verfolgungsphase, wurde um 1620, im Rückblick auf die 1580er/90er Jahre, von Johann Linden († nach 1627) in den Gesta Treverorum (Taten der Trierer) genannt: die Einsicht nämlich, dass systematische Verbrennungen von Hexen und Hexenmeistern, denen vor allem landwirtschaftliche Schäden zugeschrieben wurden, an der wirtschaftlichen Misere nichts zu ändern vermochten, sondern im Gegenteil durch zusätzliche Kosten und Belastungen die Lage noch verschlimmerten. Ins ‚kollektive Gedächtnis' scheinen derartige Argumente jedoch nicht mit dauerhafter Wirkung eingegangen zu sein. 3. Luxemburg In Luxemburg, wo erste Hexenprozesse seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisbar sind, setzte die opferreichste Phase der Verfolgungen circa 1586 ein. Von da an sind bis 1636 in verschiedenen Gegenden kontinuierliche Prozesswellen festzustellen; in der Folgezeit bewirkten der Dreißigjährige Krieg und eine Pestepidemie einen starken Rückgang der Verfahren. Eine Besonderheit stellen die Aktivitäten des Provinzialrates (conseil provincial) in Bezug auf die Führung von Hexenprozessen dar. Schon früh, nämlich am 13. August 1563, verordnete der Provinzialrat in Form einer ordonnance, die offensichtlich auf eine erste Verfolgungswelle reagierte, dass ohne ein Rechtsgutachten (Avis, Advis) gelehrter und beim Rat zugelassener Juristen kein weiterer Schritt (Einkerkerung, Folter) in Hexereiverfahren eingeleitet werden dürfe. Am 22. August 1573 wurde diese Verordnung unter Verweis auf die vorangehende erneuert, die der niederen Gerichtsbarkeit wieder einschärfte, ohne gründliche Voruntersuchung und Advise von Rechtsgelehrten keine Hexenprozesse zu führen. Da sich Luxemburg im Verbund der Spanischen Niederlande von 1556 bis 1598 unter der Herrschaft König Philipps II. befand, erging auch dort 1570 die allgemeine königliche Kriminalordnung, welche diverse vermutete Zaubereidelikte (sortilèges) berücksichtigte und diese unter andere schwere sittliche Verbrechen wie Ehebruch, Inzest oder Kindstötung einordnete. Die ordonnance des Provinzialrates von 1573 reagierte daher wohl auch auf Hexerei- und Zaubereiverfahren, die infolge der königlichen Kriminalordnung zugenommen hatten, wobei Luxemburg innerhalb der Spanischen Niederlande die verfolgungsintensivste Provinz darstellte. Die dritte Verordnung des Provinzialrates zu Hexenprozessen fiel dann am 6. April 1591 in die Jahre der schwersten Verfolgungen: Der in französischer und deutscher Sprache überlieferte Rechtstext dringt sehr tief in die Mechanismen von Anklage und Verfahrensweise ein. So werden zunächst die schweren Missstände und Exzesse in Hexensachen angeprangert, um dann in einem ersten Artikel die Praxis der Bildung von Anklageverschwörungen, so genannten Monopolen, zu untersagen. In einem weiteren Artikel wird die Folteranwendung eingeschränkt und unter juristische Kontrolle gestellt, um Exzesse zu vermeiden. Als dritter Punkt wird die Geheimhaltungspflicht der Namen der Beklagten vorgeschrieben. Die vierte und letzte Regelung betrifft die Entlohnung und die Unkosten des Gerichtspersonals; durch genaue Vorgaben sollten hier Bereicherungen und Verschwendungen unterbunden werden. Die ordonnance von 1591 zeugt von einer großen Scharfsichtigkeit der Luxemburger Obrigkeit in einer Zeit, in der Hexenprozesse alltäglich waren. Dass sie die um sich greifende Verfolgung kaum zu bremsen vermochte, hatte zumindest zweierlei Gründe: Zum einen übte die Bevölkerung durch die Forderung nach der Vernichtung der vermeintlichen Hexen großen Druck aus, zum anderen erging im September 1592 eine Verordnung Philipps II., die in keiner Weise einen juristischen Vorbehalt äußerte, sondern vom Eifer beseelt war, das Zaubereilaster an breiter Front zu bekämpfen. Darin wurden sowohl die kirchliche als auch die weltliche Obrigkeit aufgefordert, vor allen Arten von Magie, Wahrsagerei, magischer Heilkunst und Zauberei zu warnen und diese rigoros zu verfolgen. Im November 1595 folgte ein Schreiben des Staatsrats (conseil d'état) in Brüssel an alle Provinzialbehörden, welches wiederum kritisch zu den Hexenprozessen Stellung nahm und zur Vorsicht mahnte. Im Juli 1598 präzisierte der Provinzialrat zu Luxemburg in einem Urteil, welches auf Freispruch in einem Hexenprozess lautete, dass alle derartigen Prozesse zur Begutachtung an den Rat zu übergeben seien, außerdem sollte kein Advokat ohne Genehmigung des Rates Avise zu Kriminalverfahren ausstellen. Das Urteil verwies dabei auf die Verordnungen von 1563, 1573 und 1591. Im Oktober 1605 wurde diese Anordnung wiederholt. Für das Jahr 1606 ist ein Briefwechsel zwischen dem Luxemburger Provinzialrat und der erzherzoglichen Regierung in Brüssel überliefert: In einem Schreiben der Zentralregierung vom 10. April 1606 wurde die Aufforderung von 1592, die Hexen unnachgiebig zu verfolgen, wiederholt, jedoch mit der Einschränkung, dabei die Berichtspflicht an die Obergerichte zu beachten. Der Provinzialrat antwortete, dass es ihm in erster Linie um die Eindämmung der Missbräuche von Hexenprozessen gehe und die Avispflicht mittlerweile beachtet werde. Im Oktober 1606 erging dann eine Verordnung des conseil provincial, die festlegte, dass die Wahl der Notare/Gerichtsschreiber bei Hexenprozessen nicht den Klägern zu überlassen sei, sondern von den Gerichten vorgenommen werden müsse. Am 13. November 1623 wurde diese Verordnung dahingehend verschärft, dass die in Hexenprozessen tätigen Notare nun auch dem Provinzialrat selbst einen Eid leisten mussten. Durch diese enge Bindung an den Rat sollten die noch immer auftretenden Missbräuche und Komplotte verhindert werden. Das ‚Ende' der Verfolgungen in Luxemburg war also auf der Ebene von Rechtssatzungen und Verordnungen bereits zu einer Zeit vorgezeichnet, als dies in der Praxis noch keineswegs absehbar war. Der schwierige Prozess der Durchsetzung obrigkeitlicher Rechtsnormen in einem herrschaftlich uneinheitlichen, mit vielen kleinadeligen Gerichtsherrschaften durchsetzten Raum verhinderte die Realisierung einer schon früh erkennbaren Tendenz zur besseren Verfahrenskontrolle, die letztlich eine Mäßigung in der Hexenfrage bewirkt hätte. Hinzu kam die Diskrepanz zwischen Provinzial- und Zentralregierung, deren Verordnungen nicht aufeinander abgestimmt waren. Die räumliche Distanz der königlichen beziehungsweise erzherzoglichen Verwaltung zu den Vorgängen vor Ort verschleierte die Perspektive derart, dass nur die dem Zeitgeist entsprechende Hexenfurcht wahrgenommen, die daraus erwachsenden skandalösen Rechtsbrüche jedoch ignoriert wurden. Alle diese Faktoren behinderten den fortschrittlichen Ansatz der hohen Justiz des Landes Luxemburg. Die Tatsache, dass noch zu Beginn der 1680er Jahre Hexenprozesse nach klassischem Muster und ohne maßgeblichen Einfluss des Provinzialrates geführt werden konnten, beweist, dass die 1623 abreißenden Verordnungen im Laufe des 17. Jahrhunderts wieder in Vergessenheit gerieten. Das Bestreben des Rates war jedoch keineswegs wirkungslos geblieben: Eine Vielzahl von Appellationen in Hexensachen beim Provinzialrat sowie einige wenige luxemburgische Anrufungen des Großen Rates in Mecheln, des höchsten Gerichts der Niederlande, belegen, dass zumindest eine bestimmte Schicht von Opfern die juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen wusste. Waren Verfahrensfehler nachweisbar, so konnten auch Hexereiverfahren abgebrochen, beziehungsweise Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden. Wie für Lothringen so scheint auch für Luxemburg - wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung von sechs Jahren - zu gelten, dass der Dreißigjährige Krieg den Verfolgungseifer erstickte, ohne Hexereiverfahren völlig zu unterbinden. Nach 1650 wird deutlich, dass die Hexerei fast ausschließlich als Tatbestand der schweren Beleidigung verhandelt wurde. Dennoch wurde noch 1675 in Arlon eine Frau als Hexe verbrannt; um 1680 entstand in Echternach eine letzte Hexen-Hysterie, die bis 1683 auch einige Todesopfer forderte. Seit der französischen Besetzung Luxemburgs (1684) galt das Edikt Ludwigs XIV. von 1682, welches die Zauberei nur noch dann mit dem Tode ahnden ließ, wenn sie nachweislich zusammen mit einem Sakrileg verübt wurde; dieses Edikt hebelte den alten Hexereibegriff aus und beendete die auf ihm basierenden Hexenprozesse. Aufgrund der Gleichzeitigkeit der Phasen intensiver Hexenverfolgung in den drei betrachteten Großterritorien kann man Lothringen, Kurtrier und Luxemburg trotz unterschiedlicher Herrschafts- und Rechtssysteme doch als einen zusammenhängenden Verfolgungsraum ansehen. Was das Ende der Hexenprozesse betrifft, zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede. Weit stärker als die nicht an Territorialgrenzen Halt machenden Verfolgungswellen waren die Regelungen und Prozesse, die zur Beendigung der Hexereiverfolgung führten, von den inneren Strukturen der jeweiligen Länder abhängig. Hierbei kamen der Jurisdiktion zentrale Funktionen zu, doch war sie nicht allein bestimmend. Allen drei Territorien ist die Zäsur, die der Einbruch des Dreißigjährigen Krieges markiert, mit leichten zeitlichen Verschiebungen gemeinsam. Nach dessen Ende erschwerte der Fortgang kriegerischer Handlungen in Lothringen und Luxemburg ein erneutes Aufflammen größerer Hexenverfolgungen. Daraus erklärt sich auch das fehlende Interesse und die mangelnde Durchsetzungskraft der dortigen Obrigkeiten, die Verfolgungen in einem einmaligen Akt zu unterbinden. Erst die französische Besatzung etablierte die hierfür nötige starke Zentralgewalt. In Kurtrier wurde das Bemühen um ein Ende der Verfolgungen dadurch erleichtert, dass zeitgleich mit dem neuerlichen Ausbrechen von Hexenprozessen zu Beginn einer Erholungsphase nach dem Dreißigjährigen Krieg ein neuer Kurfürst die Regierung antrat. Auf die in der Vergangenheit offenbar gewordene unruhestiftende Gefahr, die von den gemeindlich geführten Prozessen ausging, reagierte der neue Landesherr schnell mit einem, wenn auch inoffiziellen, Verbot. Eine Parallele hierzu findet sich in der weiteren Region im Kurfürstentum Mainz. Nicht zuletzt ist die Beendigung der Hexenverfolgung immer auch eine politische Entscheidung gewesen, die aus Gründen der Opportunität oder administrativen Unvermögens wohl in keinem der Territorien früher hätte fallen können. In der Tat scheint sich erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine deutlich prozesskritische Haltung bei Obrigkeit und Herrschaft verbreitet zu haben, die bereits Friedrich Spee 1631 in dezidierter Form ausformuliert hatte. Auf höherer Ebene neigte der juristische Apparat schon lange vor der Politik zu einer Eindämmung der Hexereiverfahren. Dies entsprang weniger moralischen Bedenken angesichts der grausamen Verfahren, als vielmehr den dem konstruierten Delikt inhärenten Widersprüchen. Mit fortschreitender Verfahrensgenauigkeit infolge verbesserter juristischer Ausbildung wurde die rechtliche Behandlung eines Hexereifalles immer klarer sichtbar, trotz der Akzeptanz der Folter als Mittel zur Wahrheitsfindung. Die Universitäten als Ausbildungsstätten der höheren Räte und Richter waren sicher wichtige Multiplikatoren bei der Verbreitung verstärkter Bedenken bezüglich der Führung von Hexenprozessen. Dort wurde die Verbindung zur italienischen Geisteswelt hergestellt, die sowohl auf theologischer als auch weltlich-juristischer Seite lange vor dem mitteleuropäischen Raum zu einer kritischen Haltung gegenüber dem Hexenprozess gelangt war. Politik und Justiz zogen zwar dort, wo es um die Brechung
von Gewohnheitsrecht durch neues, das heißt römisches
Recht ging, an einem Strang, doch taten sie dies im Kontext der
Hexereiverfolgung nie mit der nötigen Konsequenz: Zum einen
gingen Herrschaft und Judikative mindestens bis in die zweite Hälfte
des 17. Jahrhunderts trotz eines wachsenden Erklärungsbedarfs
von der Existenz der Hexerei beziehungsweise Zauberei aus, zum anderen
scheiterten gerade in Kurtrier und Luxemburg obrigkeitliche Durchsetzungsversuche
häufig an gemeindlicher beziehungsweise herrschaftlicher Selbstbehauptung.
Langfristig stärkten die schwierigen Hexereiverfahren jedoch
die landeshoheitliche Obrigkeit, da sie in besonderem Maße
der Bürokratisierung Vorschub leisteten. Die sich daraus ergebenden
Kontrollmöglichkeiten und ein größerer Informationsfluss
‚nach oben' bedingte letztlich die Beendigung der Hexenverfolgung
durch die jeweilige Landesherrschaft. |
|
|
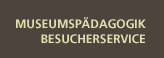 |