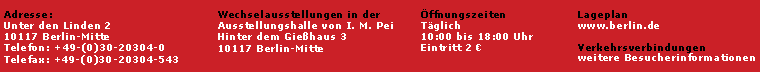|
Bundesrepublik Deutschland Die Mörder sind unter uns In der Bundesrepublik Deutschland gab es von Anfang an eine Auseinander-setzung mit der Schuldfrage, die jedoch über lange Zeit von Minderheiten getragen wurde. Direkt nach dem Ende des Krieges waren die Verbrechen der verschiedenen Organisationen des „SS-Staates“ im Bewußtsein der Bevölkerung – nicht zuletzt durch die Nürnberger Prozesse – durchaus präsent. Filme wie „Die Mörder sind unter uns“ waren bekannt, das Buch „Das Tagebuch der Anne Frank“ war 1950 erschienen. Trotzdem kann man den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozeß, der am 20. Dezember 1963 eröffnet wurde, als eine Wende in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bezeichnen. Mit diesem Prozeß begann die „Aufarbeitung der Vergangenheit“. 1961 stand Eichmann in Jerusalem vor Gericht. Dieser Prozeß entfachte ein ernsthaftes Interesse, endlich diejenigen Verbrecher vor Gericht zu bringen, die direkt an den Morden beteiligt waren. Anfang der 60er Jahre machte Rolf Hochhuths Theaterstück „Der Stellvertreter“ Furore und die Kinder der Täter, die Generation der 68er, begannen eine Theoriedebatte, die mit dem Begriff „Faschismuskritik“ in die Geschichte einging. In den 80er Jahren entzündete sich an der Frage nach dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit durch die Geschichtswissenschaft der Historikerstreit. Seit einigen Jahren wechseln sich die Themen in rascher Folge ab – Verbrechen der Wehrmacht, Denkmal für die ermordeten europäischen Juden, Zwangsarbeiter, Vertreibung usw. |
| Gerhard Richter thematisiert mit seinem Bild „Onkel Rudi“ ein Problem, über das bis dahin nicht gesprochen worden war. Es erinnert nicht nur daran, daß Mitglieder der Wehrmacht an massenhaftem Mord beteiligt gewesen sind, sondern auch daran, daß dies unser Onkel gewesen sein könnte. Erst 1996 sollte diese Erkenntnis durch die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 – 1944“ öffentlich diskutiert werden. Entstanden ist das Bild im Zusammenhang einer Ausstellung, die der Berliner Galerist René Block 1967 zum Gedenken an die Opfer des Massenmordes von Lidice organisiert hatte. Block hatte 21 Künstler aufgefordert, je ein Werk für die Ausstellung „Hommage à Lidice“, zur Verfügung zu stellen. Neben Joseph Beuys, Dieter Roth, Wolf Vostell, Günther Uecker oder Gotthard Graubner beteiligte sich auch Gerhard Richter. Die Werke waren als Geschenk für das in Planung befindliche Museum in Lidice bestimmt. | |
| Die 1960 in Berlin gezeigte Ausstellung „Die Vergangenheit mahnt“ offenbart noch vor dem Auschwitz-Prozeß das Interesse einer Minderheit, an die deutschen Verbrechen zu erinnern. Allerdings war den Ausstellungsmachern Gerhard Schoenberner und Hanno Kremer vom Beirat, der die Verwendung der öffentlichen Mittel kontrollierte, untersagt worden, Namen von hochrangigen bundesrepublikanischen Politikern und Beamten zu nennen, die vor 1945 schon einflußreich waren. Dazu gehörten z. B. Theodor Oberländer, Hans Globke oder Theodor Maunz. |
|