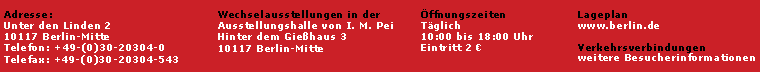|
Norwegen Das Schicksal der Juden Bis heute wird am Mythos des Widerstandes in Norwegen kaum gerüttelt. In den 80er Jahren gab es zwar eine Historiker-Debatte zwischen der sogenannten Skodvin-Schule, der man vorwarf, unbequeme Erinnerungen auszublenden, und kritischen Historikern. Doch das änderte wenig an der Leiterzählung. Aber auch in Norwegen scheint die Beschäftigung mit dem Schicksal der Juden einen Wandel im Bewußtsein der Bevölkerung bewirkt zu haben. Künstler und Filmemacher wagten einen Frontalangriff auf die zentrale Geschichtserzählung und versuchten, die tradierten Vorstellungen über Kollaboration und Widerstand zu demontieren. |
| Der Film beruht auf dem tatsächlichen „Fall Feldmann“. 1943 wurden in einem See nahe der schwedischen Grenze die Leichen des jüdischen Ehepaares Rakel und Jacob Feldmann gefunden. Die NS-Behörden legten den Fall zu den Akten, doch nach dem Krieg stellte sich heraus, daß das Ehepaar von zwei Norwegern ermordet worden war. Sie sollten die Flüchtlinge eigentlich über die Grenze schleusen. Obwohl die Täter geständig waren, wurden sie im August 1947 freigesprochen. Als Begründung führte man an, das jüdische Ehepaar sei eine Bedrohung für die Fluchtrouten nach Schweden gewesen. Die Handlung weicht etwas von den tatsächlichen Ereignissen ab. Hauptpersonen des Films sind der Journalist Madsen und der Kriminalbeamte Årnes. Der Film wurde zu einem kritischen Angriff auf den norwegischen Heimatfrontmythos der Nachkriegszeit, der Widerstandskämpfer unantastbar machte, selbst angesichts einer Anklage wegen Mordes. Das Plakat verweist anhand von Photographien des Ehepaares sowie von Fundstücken, die aus dem See geborgen wurden, auf den Hauptkonflikt des Films – den Mord aus Raffgier an unschuldigen Menschen und die Unangreifbarkeit der Mörder, da sie zum Widerstand gehörten. | |
| Zum ersten Mal wurde am 26. Januar 1994 in der Zeitung „Aftenposten“ eine Photographie veröffentlicht, die die Deportation von norwegischen Juden zeigt. Am 26. November 1942 waren Frauen, Kinder und alte Menschen verhaftet worden. Noch am selben Tag ging der Dampfer „Donau“ mit 532 Juden an Bord nach Stettin, von wo sie, in Viehwaggons gepfercht, nach Auschwitz gebracht wurden. Die Situation im Hafen von Oslo hatte der Photograph Georg W. Fossum festgehalten, der für die Heimatfront tätig war. Den Hinweis hatte Fossum von einem Informanten bei der Polizei erhalten. Auf der Photographie erkennt man ankommende Autos, in denen die verhafteten Juden saßen. Für die Aktion in Oslo verwendete die Polizei hundert Taxen. Auf dem hier ausgewählten Bild erkennt man auch das Deportationsschiff „Donau“ beim Wendemanöver im Hafen und Menschen, die zuschauen. Die Aufnahme wurde zur Ikone für die historische Wahrheit. |
|