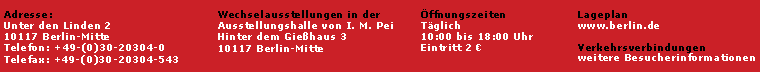|
Sowjetunion Es gab nicht nur Helden Die Zeit der Entstalinisierung und des „Tauwetters“ ermöglichte in der Sowjetunion erstmals einen kritischen Umgang mit der Leiterzählung vom heroischen Sieg. Zuerst begannen Schriftsteller die gültigen patriotisch-heroischen Klischees der Stalin-Zeit durch eine realistische Darstellung des Krieges zu ersetzen. Nun wurden in dem Heldenkult auch der Alltag und die Kriegserfahrung der einfachen Soldaten und der Schrecken von Verwundung und Tod geschildert. Wenig später, gegen Ende der 50er Jahre, entstanden auch die ersten Filme, die den Krieg nicht mehr nur als Heldenerlebnis darstellten, sondern auch als individuell erlebtes Leid. Ebenfalls in diese Zeit fielen die ersten Schilderungen des Terrors unter deutscher Besatzung, zum Beispiel des Massakers von Babij Jar in der Literatur und der Musik. Mit dem Sturz Chruščevs endete diese Entwicklung. In den Jahren der Stagnation kehrte der Personenkult zurück, nunmehr um Leonid Brežnev. Auch Stalin wurde partiell rehabilitiert. Der „Große Vaterländische Krieg“ wurde wieder Sujet von Propagandafilmen. Kritische Betrachtungen dieses Themas waren nur noch schwer zu veröffentlichen. Einzelne Filme der frühen 70er Jahre wurden erst in der Zeit der Perestrojka herausgebracht. |
| Die Figur des Kriegsversehrten tauchte in Literatur, Film und bildender Kunst in den 60er Jahren erstmals seit Kriegsende auf. Doch wurde er nicht mehr, wie noch zur Zeit des Krieges, als Held dargestellt, der seine Verstümmelung mit Mut und unbeugsamer Willenskraft, ja mit Enthusiasmus auf sich nimmt. Viel eher wurde er jetzt als gebrochener, hilfsbedürftiger Mensch wahrgenommen, der in eine traumatisierte Gesellschaft zurückkehrte, in der jeder mit sich selbst beschäftigt war. Dieses Problem griff Vadim Sidur mit seiner Plastik „Der Verwundete“ auf. Die Arbeit wurde damals in Rußland nicht bekannt. Erst seit der Perestrojka begann man, das Werk Sidurs in seiner Heimat zu würdigen. 1987 wurde ihm in Moskau ein eigenes Museum gewidmet. | |
| 1977 veröffentlichte Ales Adamovič Interviews mit Überlebenden der deutschen Okkupation in Weißrußland unter dem Titel „Ich, aus einem verbrannten Dorf“. Diese Interviews wurden zur Grundlage des Films „Komm und sieh“. Der Film schildert mit schonungslosem Naturalismus die Grausamkeit, mit der die deutschen Besatzer in Weißrußland gegen die Bevölkerung vorgingen. Wie bereits Tarkovskij wählte auch Elem Klimov die Perspektive eines Kindes, des Jungen Florja, der von einer Partisanengruppe rekrutiert wird, diese aber wenig später verliert. Er kehrt in sein Dorf zurück. Dieses ist inzwischen von den Deutschen überfallen worden. Ein Teil der Dorfbewohner hat sich in die Sümpfe gerettet, aber seine Mutter und seine Schwestern sind ermordet worden. Von Schuldgefühlen und dem Wunsch nach Rache angetrieben, irrt Florja umher. Er wird Zeuge von Greueltaten der Deutschen und einer Racheaktion der Partisanen. Das für den Verleih im Ausland produzierte Plakat stilisiert das Gesicht des Jungen in einer Weise, die gleichzeitig Rache und Versöhnung reflektiert. |
|