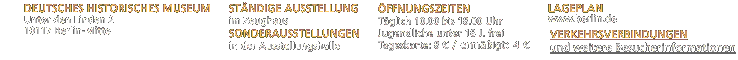Filminhalte Januar
KINEMATOGRAPHIE HEUTE - ÖSTERREICH
Nordrand
A 1999, R: Barbara Albert, D: Nina Proll, Edita Malovcic, Astrit Alihajdaraj, Michael Tanczos, Margarethe Tiesel, 103'
Am Nordrand von Wien, Mitte der Neunziger Jahre: Die lebenslustige Jasmin, die pflichtbewusste Serbin Tamara und ihr Freund Roman, der schweigsame bosnische Flüchtling Senad und der junge rumänische Lebenskünstler Valentin, fünf junge Menschen unterschiedlicher Herkunft, treffen aufeinander und teilen für kurze Zeit ihr Leben und ihre Sehnsucht nach Liebe. Sie finden ein wenig Wärme und Geborgenheit in der Anonymität der Großstadt. Am Ende hat die Divergenz ihrer Träume die jungen Glückssucher längst wieder auseinander getrieben, aber bei jedem bleibt etwas zurück, ein Stück Leben des anderen.
"Auf die Frage, wie man heute von Sozialtristesse und Schicksalen an der Peripherie erzählen kann, antwortet Barbara Albert mit Filmbildern, in denen die anteilnehmende Nähe zu den Figuren regelmäßig über den Naturalismus triumphiert." (Gerhard Midding)
Barbara Alberts Spielfilmdebüt Nordrand vertrat Österreich 1999 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig. Die Schauspielerin Nina Proll bekam dort den Preis als Beste Nachwuchsdarstellerin.
am 05.01. um 18.00 Uhr, am 07.01. um 21.00 Uhr
Eröffnung KINEMATOGRAPHIE HEUTE - ÖSTERREICH
Kurzfilmprogramm
Ägypten
A 1999, R: Kathrin Resetarits, 10'
Nüchterne Schwarzweiß-Aufnahmen zeigen, wie beispielsweise eine James-Bond-Szene, ein Wienerlied oder die Geschichte einer Schatzsuche in Gebärdensprache aussieht. "Eine kleine, andeutungshafte Einführung in eine Wahrnehmungsweise, in der man die tönende Welt sieht, ohne zu hören." (Drehli Robnik)
Speak Easy
A 1997, R: Mirjam Unger, 35'
"Ein ganz normaler Tag in der Stadt. 11 Jugendliche bei einer ebenso normalen Tätigkeit. Sie telefonieren. Sie reden über nichts Besonderes: über Langeweile, Zusammensein oder Nicht-Zusammensein, Ziele und Ziellosigkeit, Sex, Unsicherheit und ihren vagen Wunsch nach mehr. In dieser Alltäglichkeit und scheinbaren Trivialität gewähren sie Einblick in ihr Befinden, das sie sonst nur unter sich preisgeben." (Mirjam Unger)
Inter-View
A 1999, R: Jessica Hausner, D: Klaus Händl, Melina Oberndorfer, Birgit Doll, Hakon Hirzenberger, 45'
Ein junger Mann interviewt Leute auf der Straße. Er sucht nach Möglichkeiten von Glück, er befragt die Menschen nach ihrem Leben, auch, um für sich selbst Antworten zu finden. Dabei trifft er auf eine Frau, die, nach mehreren Misserfolgen, ihrem Leben schließlich eine Seite des Glücks abgewinnen kann - und trotzdem kann sie ihm keine befriedigende Antwort geben.
"Jessica Hausner entwickelt in Inter-View eine intensive psychologische Studie über seelische Vereinsamung und gestörte Kommunikation. Das Interview als formales und gängiges Mittel zum Gedanken- und Informationsaustausch wird hier paradoxerweise zum schlimmsten Feind zwischenmenschlicher Verständigung. Indem die junge Regisseurin gestellte Dialoge mit >echten< Statements vermischt, erreicht sie in ihrem Film eine irritierende Wirklichkeitsnähe." (www.3sat.de)
Große Beachtung fand Hausners Film beim Nachwuchswettbewerb auf den Filmfestspielen in Cannes und erhielt eine lobende Erwähnung der "Cinéfondation"
am 05.01. um 20.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung der Filmreihe in Anwesenheit S.E. Dr. Christian Prosl, Botschafter der Republik Österreich
WIEDERENTDECKT
Playgirl
BRD 1966, R/B/P: Will Tremper, D: Eva Renzi, Harald Leipnitz, Paul Hubschmid, Umberto Orsini, Paul Kuhn, 90'
Mitte der 60er Jahre, Sommer in West-Berlin. Eine junge Frau kommt zum ersten Mal in die Stadt, verdreht mehreren Männern den Kopf, arbeitet als Fotomodel, läßt sich treiben, lebenshungrig, neugierig und unbekümmert. Die Männer begehren sie, doch entscheiden kann und will sie sich nicht. Sie ist launisch, sie spielt und provoziert. Als sie bei Fotoaufnahmen an der Berliner Mauer posiert und dafür böse Blicke erntet, erwidert sie gereizt: "Gebt doch nicht so an mit Eurer Mauer." West-Berlin definiert sich in diesem Film nicht über seine Vergangenheit und die Gegenwart der Teilung, sondern über die Konkurrenz mit Rom und Paris, über Optimismus und amerikanischen Lebensstil und auch über die Freiheit zum kultivierten Nichtstun
Playgirl präsentiert die Momentaufnahme einer Stadt, stylish fotografiert und getragen von einer beschwingten, jazzigen Filmmusik von Peter Thomas, gespielt von Klaus Doldinger und Paul Kuhn. Auf kongeniale Weise verkörpert der Star, die damals erst zwanzigjährige, im August 2005 gestorbene Eva Renzi den Abschied von gestern. Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Will Tremper (1928-1998) betätigt sich hier als wahrer Vertreter des Autorenfilms, der aus seiner Zeit als Sensationsreporter allerdings auch einen klaren Sinn für das kommerziell Machbare und das Triviale, für Mode und Äußerlichkeiten mitbrachte. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, gelingt es Tremper mit Playgirl, dem deutschen Kino den Charme der Nouvelle Vague zu erschließen. Seinen unverbrauchten Blick hat sich Playgirl auch 40 Jahre nach seiner Premiere erhalten.
Einführung: Philipp Stiasny
Eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit CineGraph Babelsberg und
dem Bundesarchiv-Filmarchiv
am 06.01. um 19.00 Uhr
KINEMATOGRAPHIE HEUTE - ÖSTERREICH
Indien
A 1993, R: Paul Harather, D: Alfred Dorfer, Josef Hader, Georg Hader, Maria Hofstätter, 90'
Indien spielt nicht in Indien. Indien steht als sehnsuchtsvolle Phantasie zweier höchst unterschiedlicher und seltsamer Charaktere, die in ihrer Mission als Hotel- und Gastronomie-Inspektoren durch die niederösterreichische Provinz fahren. Einer der Männer ist dick und sehr wortkarg, der andere ist lang und dünn und kann den ganzen Tag reden. Man erkennt gleich, die beiden haben sich nicht gesucht, müssen sich aber nun auf ihrer Fahrt in Bösels (Josef Hader) altem Ford irgendwie arrangieren. Dabei gibt es viel zu lachen, und am Ende können auch die beiden nicht mehr leugnen, dass sie sich mögen.
Aus der gleichnamigen, gemeinsamen Kabarettshow entwickelten Josef Hader und Alfred Dorfer ein Drehbuch, das Paul Harather 1993 mit den beiden als Hauptdarstellern verfilmte. Indien wurde zu einem der erfolgreichsten Filme Österreichs.
"Die Mischung aus Heimatfilm und Roadmovie, Posse, Märchen und Tragödie lebt von einer spezifisch wienerischen Variante schwarzen Humors, ist jedoch kein Klamauk, sondern thematisiert die Bedeutung von Toleranz, Freundschaft und Tod." (www.dieterwunderlich.de)
am 06.01. um 21.00 Uhr, am 08.01. um 19.00 Uhr
Crash Test Dummies
A 2005, R: Jörg Kalt, D: Maria Popistasu, Bogdan Dumitrache, Simon Schwarz, Kathrin Resetarits, Barbara Albert, 93'
Crash Test Dummies werden auf der ganzen Welt verwendet, um festzustellen, ob die Insassen-Rückhaltesysteme der Autos (hauptsächlich Sitzgurte und Airbags) den gesetzlichen Bestimmungen bei Frontalzusammenstößen entsprechen. Bei Crash-Tests, in denen Menschen statt Dummies eingesetzt werden, geht es weniger um Geschwindigkeiten als um Beschleunigung.
Jörg Kalts Film Crash Test Dummies vermittelt das Gefühl von ständiger Bewegung: Bewegung und Aufbruchstimmung. "Der Film riskiert die prekäre Gratwanderung, Komödie und Melodram fast zeitgleich zu bedienen. Und gerade das ist ungewöhnlich im österreichischen Kino: Dieser Film operiert heiter und gelassen, mit einem angenehm unmoralischen Schulterzucken mit den ,großen' Themen von Selbstbestimmung, Gender-Politik und Migrationsproblematik, ganz ohne die ,richtigen' Lösungen zu verordnen. (Birgit Flos, Intendantin der Diagonale, Graz)" Jörg Kalt sagt selbst über seinen Film: "In meinem Film geht es um unkontrollierte Zufälle und kontrollierte Unfälle, um das Herz der Tragik und den Schmerz der Komik, um die Liebe und, nicht zuletzt, um Kühe."
Crash Test Dummies lief auf der Berlinale im Internationalen Forum des Jungen Films 2005.
am 07.01. um 19.00 Uhr, am 08.01. um 21.00 Uhr
DAS FILMARCHIV AUSTRIA
Wiener Bilderbogen 1
A ca. 1926, R: Louis Seel, ca. 6', viragierte Kopie
Künstlerfarben
D ca. 1924, R: Louis Seel, ca. 3'
Die ideale Filmerzeugung
A, 1913/14, R: Ludwig Schaschek, ca. 5', Trickfilm. Virage über die Desmet-Methode
Stadt in Sicht
D 1922, R: Henrik Galeen, D: Edith Posca, Friedrich Traeger, Otto Treptow, Harry Nestor, 60'
"Ein gutes, feines, verdichtetes Werk, im Kielwasser der Gedanklichkeit und der Psychologie hinstreichend; durchaus im Schlepptau künstlerischen Wollens und Vermögens. Jede Situation bildhaft dem Gedanken, dem Symbol angepasst, und jede Szene photographisch geistreich festgehalten. Wasserbilder, Spiegelungen von köstlichstem und seltenstem Reiz." (Der Kinematograph, Düsseldorf, Nr. 836, 1923)
Stadt in Sicht galt bisher als eine der verschollenen Arbeiten von Henrik Galeen, umso größer war die Sensation, als im Zuge der Katalogisierungsarbeiten des Filmarchiv Austria eine praktisch vollständig erhaltene Kopie in den Nitrobeständen des Filmdepot Laxenburg identifiziert werden konnte. Schon nach der ersten Sichtung war klar, dass dieser Fund zu den großen internationalen Archiventdeckungen des Jahres zu zählen ist.
Die erhaltene Filmkopie von Stadt in Sicht wurde bei Haghe-Film in Amsterdam auf Sicherheitsmaterial umkopiert. In einem tschechischen Speziallabor erfolgte anschließend die manuelle, genau der Nitrofilmvorlage entsprechende chemische Färbung der einzelnen Sequenzen mittels authentischer Rezepturen, womit eine optimale Vorführkopie als handgefertigtes Einzelstück hergestellt werden konnte. ( www.viennale.at )
Einführung: Nikolaus Wostry
Klavierbegleitung: Peter Gotthardt
am 12.01. um 19.00 Uhr
DAS FILMARCHIV AUSTRIA
Bei den Tiroler Kriegsadlern im Winter
A 1916, R: unbekannt, ca. 7'
Romeo und Julia im Schnee
D 1920, R: Ernst Lubitsch, D: Jacob Tiedtke, Marga Köhler, Lotte Neumann, Gustav von Wangenheim, 44'
"Lubitsch lässt die Geschichte von Romeo und Julia in einem winterlichen Alpendorf spielen; der ländliche Charakter dieser Szenerie gilt als Zeichen für eine intakte Welt, die im Einklang mit der Natur steht. (.)
Lubitsch hat sich einen Jux daraus gemacht, theatralische Elemente der Vorlage durch burleske Späße, durch den Mummenschanz der Kostümierung und durch übertriebene Gestik zu persiflieren. Mit Parallelmontagen, die nicht auf einen platten Kontrast der Charaktere, sondern auf eine ironische Auflösung ihrer Handlungsabsichten hinauslaufen, und mit einer Spielführung, in der die Körpersprache als zentrales Ausdrucks- und Verständigungsmittel gleichzeitig den Verfall verbaler Ausdrucksfähigkeit dokumentiert, entgeht Lubitsch dem Niveau von Plotten über die Beschränktheit ländlicher Verhaltensweisen. Dennoch scheint das Ganze nicht mehr als eine Fingerübung gewesen zu sein. In dem nach Art des Kammerspiels inszenierten Prolog zeigt sich ein anderes Talent. Winzige Nuancen des Mienenspiels des Richters und des Schreibers reichen aus, die satirische Skizze einer Gesellschaft zu zeichnen, in der die formale Gerichtsbarkeit nichts mehr zu tun hat mit der Idee von Gerechtigkeit. Aber mit der Weiterentwicklung dieser Geschichte wäre ein anderer - und gar nicht mehr so volkstümlicher Film entstanden." (Werner Sudendorf)
Romeo und Julia im Schnee galt lange als verschollen. 1999 entdeckte das Filmarchiv Austria den Film in seinen Beständen und rekonstruierte gemeinsam mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin aus einem Nitronegativ und einem kolorierten Positiv eine viragierte Fassung des Films, die im Zeughauskino zu sehen sein wird.
Einführung: Nikolaus Wostry
Klavierbegleitung: Peter Gotthardt
am 12.01. um 21.00 Uhr
KINEMATOGRAPHIE HEUTE - ÖSTERREICH
Funny Games
A 1997, R: Michael Haneke, D: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Frank Giering, Arno Frisch, 103'
So viel Schrecken war selten im Kino, und selten sahen sich Zuschauer so konsequent in der Hoffnung auf eine bessere Wende der Story getäuscht - auch dann noch, als sie an ein happy end schon lange nicht mehr glaubten. Hanekes kühl kalkulierte und mit großartigen Schauspielern aufwartende, konsequent bis an ihr mitleidloses Ende getriebene Geschichte verstörte das Publikum und wurde zum internationalen Erfolg. Wie eine dreiköpfige Familie von zwei Jugendlichen terrorisiert wird, gerät ihm zu einer Studie über Gewalt, über den heimlichen und unheimlichen Voyeurismus der Zuschauer, denen immer deutlicher wird, dass sie filmische Grausamkeiten mit ansehen, ja, dass diese nur "funktionieren", weil ihre Erwartungen an Filme Teil des Spiels sind, welches Filme - und dieser besonders deutlich - mit ihnen treiben.
am 13.01. um 19.00 Uhr, am 14.01. um 21.00 Uhr
EXPERIMENTALFILMPROGRAMM
Österreich hat in Filmdingen schon immer etwas anders als Deutschland getickt. So gab es zum Beispiel den Bruch nicht, den hierzulande das Oberhausener Manifest verursacht hat. Dafür blühten seit den frühen 60er Jahren die verschiedensten Formen von Experimentalfilm auf, die man mit Namen wie Hans Scheugl, Peter Kubelka oder Kurt Kren verbindet. Eine gute Experimentalfilmszene ist immer noch in Österreich aktiv; vor allem in den letzten Jahren haben sich dort neue Namen an die Oberfläche geschwommen. Einer der profiliertesten österreichischen Experimentalfilmer ist Peter Tscherkassky, von dem das Zeughauskino in diesem Programm zwei Filme zeigt.
Instructions for a Light and Sound Machine
A 2005, R: Peter Tscherkassky, 17'
"In Un chien andalou haben Buñuel und Dali symbolträchtig einen Augapfel aufgeschlitzt und somit ihre Zerstörungslust kinematographischer Wahrnehmungsgewohnheiten kundgetan. In Instructions for a Light and Sound Machine erinnert sich Peter Tscherkassky an diese Urmetapher des Kinos und treibt sie ein Stückchen weiter. Mit ungeheuerer Brutalität drückt er seinem Protagonisten (Eli Wallach) die Augen ein, wendet sie nach Innen und konfrontiert ihn in Folge mit den Grundbedingungen seiner Existenz als Filmfigur. Selten zuvor trat der filmische Furor mehr in Aktion. Eine Großtat." (Lukas Maurer)
" Instructions for a Light and Sound Machine ist der Versuch, einen römischen Western in eine griechische Tragödie zu transformieren." (Peter Tscherkassky)
Outer Space
A 1999, R: Peter Tscherkassky, 10'
"Tscherkassky bedrängt seine Heldin, treibt sie zum Äußersten: Immer wieder, so scheint es, schlägt sie gegen die Kinomaschine, bis die Bilder zu stottern beginnen, aus der Fassung geraten. Outer Space , ein Schocker filmischer Fehlfunktionen, ein Hellraiser des Avantgarde-Kinos, beschwört ein Inferno herauf, das seine Vernichtung (der Erzählung, der Illusion) mit ungeahnter Schönheit betreibt." (Stefan Grissemann)
Mirror Mechanics
A 2005, R: Siegfried A. Fruhauf, 8'
"Dieser Film berichtet vom Kino und den Vorgängen darin. Er verrät damit kein Geheimnis, sondern versucht im Sinne eines Sehens des Sehens, das was wir im Kino tun und auch außerfilmisch relevant sein kann, in ein visuell reizvolles und fesselndes Ereignis zu überführen." (Siegfried A. Fruhauf)
Alone. Life Wastes Andy Hardy
A 1998, R: Martin Arnold, 15'
"In Alone. ... gebiert die Kreuzung dreier harmloser Teenager-Filme miteinander ein ödipales Drama, in dem nicht nur die Mutterliebe zur blanken Geilheit mutiert." (Dirk Schaefer)
Metropolen des Leichtsinns
A 2005, R: Peter Tscherkassky, 17'
Metropolen des Leichtsinns ist meist nach rein formalen Anschlüssen montiert, nach Bewegungen, Farben und Formen. Draschan dazu: "Mir geht es auch immer darum, über das Denkvermögen selber zu reflektieren: Man kann eben durch formale Griffe vollkommen disparates oder sinnloses Material, das von der Ästhetik her überhaupt nicht zusammen passt, vermeintlich sinnvoll zusammenfügen und umgekehrt. Ich bewege mich an der Grenze zum Unsinn."
Bitcrusher
A 2004, R: Harald Holba, 11'
"Der Raum, das ist das, was den Blick aufhält, das, worauf die Augen treffen. (Georges Perec: Träume von Räumen). In Bitcrusher entstehen Räume nicht nur durch den Blick, sondern auch durch die Bewegung in ihnen. Diese Interaktion von Mensch und Architektur lässt Begrenzungen verschwimmen, Oberflächen brüchig werden, Räume ineinander übergehen. Der viel zitierte virtuelle Raum bekommt hier eine neue visuelle und taktile Dimension." (Andrea Pollach)
am 13.01. um 21.00 Uhr
Le temps du loup - Wolfzeit:
F/ A/ D 2003, R: Michael Haneke, D: Lucas Biscombe, Anaïs Demoustier, Hakim Taleb, Isabelle Huppert, 113' OmU
Was ist die Wolfzeit für eine Zeit? Sie war nicht vor 100 Jahren, sie ist nicht in zwei Jahren, sie war nicht letzte Woche und wird nicht morgen sein - und doch kann Wolfzeit zu jeder Zeit sein. Wolfzeit ist eine Stimmung, wie sie nach der Apokalypse, kurz vor dem Untergang herrschen könnte: Jeder ist sich selbst der nächste, jeder ist jedem ein Wolf. Wie dünn ist die warme Decke der Zivilisation, was bleibt von unseren Werten übrig, wenn Menschen einer Extremsituation ausgesetzt sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich Michael Haneke in seinem Film.
Haneke inszeniert ein Leben nach der Katastrophe. Dabei interessiert er sich nicht für Ort, Zeit und Natur des Ereignisses, sondern beobachtet, wie sich eine kleine Familie deren Auswirkungen stellt. "Haneke lässt sie in einer vom dicken Nebel eingehüllten, himmellosen und fast immer verdunkelten Landschaft herumirren, die ansonsten keinerlei futuristische Attribute aufweist. (.) Dass es bei Haneke nicht lange dauert, bis die Familie auseinander fällt und in der Schicksalsgemeinschaft, der sie sich anschließt, die Menschlichkeit dem Gesetz des Stärkeren geopfert wird, verwundert kaum." (Martin Rosefeldt)
am 14.01. um 19.00 Uhr, am 15.01. um 21.00 Uhr
Hotel
A/ D 2004, R: Jessica Hausner, D: Birgit Minichmayr, Franziska Weisz, Marlene Streeruwitz, Rosa Weissnix, 82' OmeU
In einem Interview für den "Standard" anlässlich ihres Films Lovely Rita (2001) sagte Jessica Hausner einmal: "Früher hat das oft gestimmt: Österreichischer Film ist langweilig. Heute ist das nicht mehr so oft der Fall." Dass an dieser Aussage was dran ist, hat auch mit ihren eigenen Filmen zu tun. Seit ein paar Jahren macht neben etablierten Regisseuren (wie Xaver Schwarzenberger, Ulrich Seidl oder Michael Haneke) eine junge Generation von Filmemacher(inne)n auf sich aufmerksam, deren Filme auf vielen Festivals im In- und Ausland augenfällig werden. Jessica Hausner ist Gründungsmitglied der Produktionsfirma "coop 99" (Barbara Albert, Jessica Hausner, Martin Gschlacht, Antonin Svoboda), eine Plattform für Macher, deren Filme für Authentizität, persönliche Stellungnahme und individuelle Machart stehen. Hotel ist nach Lovely Rita Hausners zweiter Spielfilm und lief ebenso wie der erste in der Cannes-Nebenreihe "Un Certain Regard". Auf dem Grazer Filmfestival bekam sie den großen Diagonale-Preis für ihren Film, "in dem es um die mysteriösen Vorgänge und um das Verschwinden einer Rezeptionistin in einem Hotel geht." (www.derstandard.at)
15.01. um 19.00 Uhr, am 22.01. um 21.00 Uhr
DAS LITERARISCHE FERNSEHEN
"Dennoch die Schwerter halten.". Literatur im Fernsehen
Ein "Videoschnipsel"-Vortrag von Jürgen Kuttner
Der Kulturwissenschaftler und Performer Jürgen Kuttner präsentiert und kommentiert Fernsehausschnitte aus Ost und West. In den Ausschnitten kommen Autoren zu Wort, wird Literatur vermittelt und Adaptionen präsentiert - ein neuer assoziativer Beitrag zu Kuttners Kulturgeschichte der Television, der als Eröffnungsvortrag die Tagung einleiten wird.
am 19.01. um 19.00 Uhr
Eintritt frei
Rita (Anlauf)
DDR-Fernsehen 1976 (1971), R: Egon Günther, B: Benito Wogatzki, D: Jutta Hoffmann, Eberhard Esche, Fred Düren, Klaus Piontek u.a., 58'
Ein Gegenwartsstück, mit dem das Filmteam die Reformpolitik des VIII. Parteitags der SED unterstützen wollte. Nach dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker ist ein Aufbruch in der DDR spürbar. Basierend auf der Erzählung "Die Wichelsbacher Initiative" des Autors Wogatzki erzählt Günther eine Liebesgeschichte, die von dieser Stimmung getragen wird und zugleich Einblicke in die Wirklichkeit sozialistischer Betriebe gewährt. Entstanden ist ein unkonventioneller Fernsehfilm, der auch durch seine formale Experimentierfreudigkeit überzeugt. Wir zeigen die kürzere, aber gut erhaltene Fassung Rita, sowie im Anschluss die fehlenden Sequenzen aus der ursprünglichen Version Anlauf .
Gäste: Egon Günther (Regie) und Roland Dressel (Kamera)
Eintritt frei
am 19.01. um 21.00 Uhr
"Vom Buch zum Film". Autoren und Regisseure im Gespräch
Eine Podiumsdiskussion mit den Autoren Klaus Poche, Günter Kunert, Torsten Schulz und den Regisseuren Frank Beyer und Hans-Werner Honert.
Die Gesprächsrunde erweitert die Tagung "Das literarische Fernsehen. Beiträge zur deutsch-deutschen Medienkultur" um das Thema der künstlerischen Praxis im Fernsehen. Autoren und Regisseure gehen den Fragen nach, warum Autoren für die Massenmedien schreiben, wie und warum ein Text adaptiert wird bzw. wie die Regisseure mit den literarischen Vorlagen umgehen. Ziel der Diskussion ist ein Austausch über die Erfahrungen von Schriftstellern und Regisseuren mit dem Fernsehen in Ost und West.
Zur Einführung wird gezeigt:
Eine Liebesgeschichte
nach einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Günter Kunert
Fernsehzentrum Berlin/ DEFA 1953, R: Richard Groschopp, B: Günter Kunert, D: Rudolph Wessely, Herwart Grosse, Horst Schönemann, Christel und Ulrich Thein, 6'
Ein satirischer Kurzspielfilm aus der Reihe Das Stacheltier : Ein Schriftsteller scheitert mit seinem Text an bornierten Redakteuren, die von ihm zuerst mehr politische Bekenntnisse fordern und nach einer Überarbeitung dann wieder mehr "lebensechte Kunst" einklagen. Eine Kritik an unberechenbaren Kurswechseln der DDR-Kulturpolitik und deren Funktionären als "überflüssige Zeitgenossen".
am 20.01. um 18.00 Uhr
Eintritt frei
Selbstversuch
Fernsehen der DDR 1990, R: Peter Vogel, B: Christa Wolf/ Eberhard Görner, D: Johanna Schall, Hansjürgen Hurrig, Katrin Klein, Henry Hübchen, Ute Lubosch u.a., 103'
Die junge ehrgeizige Wissenschaftlerin Johanna stellt sich als Versuchsperson mutig für eine Geschlechtsumwandlung zur Verfügung. Wegen ihrer weiblichen Erinnerungen kann sie jedoch keine Identität als Mann finden: Das Experiment scheitert an der Doppelpersönlichkeit Johanns sowie an den Erwartungen seiner Umwelt. Der aufwändige Film nach Christa Wolfs gleichnamiger Erzählung spielt in einer gedachten Zukunft, die nicht zufällig durch Symbole westlichen Fortschritts gezeichnet ist. Auf dieser Folie werden sowohl tradierte Geschlechterrollen als auch die Grenzen der Humanforschung hinterfragt. Damit ist in der Spätzeit des DDR-Fernsehens eine herausragende Produktion entstanden, die die Potentiale der ostdeutschen Fernsehdramatik noch einmal aufzeigt.
Gäste: Peter Vogel (Regie), Eberhard Görner (Buch), Alfried Nehring (Dramaturgie
am 20.01. um 20.00 Uhr
Eintritt frei
Irrlicht und Feuer
DDR-Fernsehen 1966, R: Heinz Thiel und Horst E. Brandt, B: Max von der Grün/ Gerhard Bengsch, D: Günther Simon, Irma Münch, Lissy Tempelhof, Helga Göring, Walter Lendrich, Gerd Ehlers u.a., 2 Teile (96' und 92')
Der umstrittene Ruhrgebiets-Roman des ehemaligen Bergmanns Max von der Grün wurde vom DDR-Fernsehen ins Bild gesetzt und dann 1968 auf Initiative von Günter Gaus als erster ostdeutscher TV-Film in der ARD gezeigt. Hervorzuheben ist die untypische Zurückhaltung in der ideologischen Aufladung eines zeitgenössischen Stoffes aus dem Westen und der klare Blick auf einen ausgeblendeten Aspekt westdeutscher Realität. Der Film zeigt die bundesdeutsche Arbeitswelt mit ihren systemübergreifenden Abhängigkeiten und artikuliert einen Wunsch nach Selbstverwirklichung, der in Ost oder West zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht grundsätzlich verschieden war: Auf beiden Seiten stand das individuelle Bemühen im Vordergrund, das private Glück gegenüber gesellschaftlichen Zwängen behaupten zu können.
Gäste: Irma Münch, Lissy Tempelhof, Madeleine Lierck
am 21.01. um 19.00 Uhr
Eintritt frei
Guten Morgen, Du Schöne
Folge I: Susanne, Gudrun, Angela
DDR-Fernsehen 1978/90, R: Hans-Werner Honert, B: Maxie Wander, D: Frauke Poolmann, Elke Drechsler, Christine Reinhold, 45'
Folge VI: Rosi
DDR-Fernsehen 1980, R: Thomas Langhoff, B: Maxie Wander, D: Jutta Wachowiak, Jürgen Gosch, 29'
Basierend auf den lebensgeschichtlichen Texten von Maxie Wander haben die Regisseure Honert und Langhoff Gespräche mit ostdeutschen Frauen für das DDR-Fernsehen inszeniert. Die erste Folge der Sendung wurde verboten und erst 1990 ausgestrahlt. Im ersten hier gezeigten Film nach realen Interviews reflektieren junge Frauen ihre persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen in ungewohnt kritischer und nicht konformer Weise; der Beitrag Rosi hingegen basiert auf der fingierten Biografie einer Sekretärin, die sich Fragen nach der menschlichen Natur stellt.
Gäste: Hans-Werner Honert (Regie), Jutta Wachowiak (Hauptdarstellerin) und Sonja Kühne (Dramaturgie)
am 22.01. um 18.00 Uhr
Eintritt frei
AUS DER SAMMLUNG DES DHM
It Happened Here
GB 1966, R: Kevin Brownlow, Andrew Mollo, D: Pauline Murray, Sebastian Shaw, Fiona Leland, 101' OF
Was wäre gewesen, wenn die Deutschen in England nicht nur gelandet wären, sondern es vollkommen besetzt hätten? In einem orwellesken Alptraum entwirft Brownlow das Szenario eines Königreichs, in dem Partisanen erbittert gegen die "Blackshirts" ankämpfen und für ihre Überzeugung sterben müssen, während die große Masse der Engländer sich den Maßnahmen der Nationalsozialisten ohne Widerstand unterwirft. Der Film widersprach provokativ dem Mythos, dass es für die Engländer völlig ausgeschlossen wäre, mit den Nazis zu kollaborieren.
Kevin Brownlow war erst 18 Jahre alt und sein Co-Regisseur Andrew Mollo 16 Jahre als sie 1956 mit den Arbeiten zu diesem pseudo-dokumentarischen Spielfilm begannen. Nach Jahren harter Arbeit und mit der Hilfe von hunderten Volontären wurde It Happened Here erst 1964 fertig gestellt. Und als United Artists den Film dann 1966 erstmals zeigte, waren sieben Minuten kontroversen Materials der Schere zum Opfer gefallen. Im Zeughauskino kommt die vollständig rekonstruierte Fassung zur Aufführung.
am 26.01. um 19.00 Uhr
KINEMATOGRAPHIE HEUTE - ÖSTERREICH
Hundstage
A 2001, R: Ulrich Seidl, D: Maria Hofstätter, Alfred Mrva, Erich Finsches, Gerti Lehner, 121' OmU
Hundstage sind fünf locker aneinander gereihte, ineinander verwobene Geschichten aus der Wiener Vorstadt. Man lernt Menschen kennen, die so sind wie sie sind. Seidl offenbart die ganz normale Hölle des Alltags. Er hat für Hundstage zum ersten Mal ein Drehbuch benutzt, das aber keine Dialoge beinhaltete, beim Drehen wurde improvisiert.
"Sternstunde des dokumentarischen Spielfilms. Denn Seidls Szenen sind gestellt, sie sind nicht wirklich dokumentarisch, sie wirken nur so. Diese Illusion nimmt einen als Zuschauer gefangen. Sie ist einzigartig, beeindruckend, grandios. Und sie polarisiert. Es gibt genügend Menschen, die so eine Wahrheit nicht ertragen wollen, solchen Menschen nicht einmal auf der Leinwand begegnen wollen. Es braucht Mut, sich einen Seidl-Film anzuschauen." (www.br-online.de)
Ulrich Seidl sagt in einem Interview: "Ich habe über Jahre hinweg Material gesammelt, ohne genau zu wissen, was für einen Film ich daraus machen würde. Ich hatte stapelweise Notizen über Begegnungen mit Menschen, über Dinge, die mir erzählt wurden oder die ich selbst erlebt habe. Irgendwann habe ich angefangen, dieses Material zu Geschichten zu verarbeiten. Vieles daran ist Fiktion, aber alle sind der Wirklichkeit entsprungen, basieren auf tatsächlichen Menschen."
am 26.01. um 21.00 Uhr
Die Siebtelbauern
A/ D 1998, R: Stefan Ruzowitzky, D: Simon Schwarz, Sophie Rois, Lars Rudolph, Julia Gschnitzer, Ulrich Wildgruber, 94'
Die Siebtelbauern spielt im ländlich-bäuerlichen Milieu Österreichs in den 20er Jahren. Es ist eine Welt patriarchalischer Strukturen und scharfer sozialer Gegensätze, die viel Stoff für dramatische Verwicklungen bieten. Ein Bauer ist ermordet worden, der nun Hof und Gut testamentarisch seinen zehn Knechten und Mägden hinterlässt. Sieben der zehn nehmen die Herausforderung an und rufen damit viel Neid und Missgunst aus der Umgebung auf den Plan - schließlich wird damit die gesamte bäuerliche Welt auf den Kopf gestellt: Seit wann kann denn ein Knecht ein Bauer sein? Regisseur Ruzowitzky selbst nennt seinen Film einen "Alpenwestern".
" Die Siebtelbauern ist eine eigenwillige, erfreulich rücksichtslose Mischung aus Elementen des >kritischen Heimatfilms<, des Brecht'schen Lehrstücks, des Westerns und der filmischen Oper der Emotionen." (Georg Seeßlen) "Ich siedle Menschen mit großen Gefühlen und abenteuerlichen Erlebnissen in den Bilderwelten des Heimatfilms an", sagt Ruzowitzky, "und erzähle eine Geschichte, in der sich sowohl Anklänge an Bertoluccis 1900 wie auch an Leones Spiel mir das Lied vom Tod finden."
am 27.01. um 19.00 Uhr
am 29.01. um 21.00 Uhr
Suzie Washington
A 1998, R: Florian Flicker, D: Birgit Doll, August Zirner, Wolfram Berger, Karl Ferdinand Kratzl, 87'
Mit gefälschten Papieren wird die junge Georgierin Nana auf dem Flughafen von Wien festgehalten. Eine Weiterreise ins geliebte Traumland USA kann sie zunächst vergessen. Doch bevor sie abgeschoben werden kann, gelingt ihr die Flucht in die Alpen. Dort, in der Urlaubsidylle Österreichs, trifft sie jede Menge skurriler Typen.
Nana, "als resolute Alice im Mozartkugelland" erzählt "eine universelle Geschichte von Heimatverlust und -suche sowie von der Magie und Beschränktheit zwischenmenschlicher Verständigung. Auch in der zweiten Hälfte des Films, wenn vom anfänglichen Road Movie sanft zum finalen Kammerspiel übergeleitet wird, behält die Handlung ihre scharfe Akzentuierung bei." (Claus Löser)
"Mit seinem zweiten Film Suzie Washington ist dem österreichischen Regisseur Florian Flicker etwas Seltenes gelungen: ein brisantes Thema mit Würde zu erzählen. Ihm ist gelungen, sein Heimatland Österreich zwischen Tourismusparadies und Fremdenfeindlichkeit zu kritisieren, ohne es zu denunzieren. Und ihm ist ein Film gelungen, der vor allem eine kleine menschliche Komödie voll stillen, eigenen Humors ist." (Christina Tilman)
am 27.01. um 21.00 Uhr
am 29.01. um 19.00 Uhr
Elsewhere
A 2001, R: Niklaus Geyrhalter, 12 x 20' (240') OmU
"Ein Mann findet ein gefrorenes Rentier ohne Kopf. Eine Frau verbringt Stunden, um für ihre Schweine zu kochen. Zwei Männer, die zwischen Eisbergen sitzen, beschweren sich über Brigitte Bardot und träumen von nackten weißen Frauen. Kinder spielen Nintendo im Regenwald. Kurze Momente von anderswo." (www.elsewhere.at)
In dem vierstündigen Dokumentarfilm nähert sich Geyrhalter behutsam verschiedenen Lebensformen jenseits der Zivilisation. In zwölf Episoden erzählt er Geschichten aus einer anderen Welt, berichtet von Traditionen und kleinen Eigenheiten, von dem Stolz und der Schönheit der Menschen und der Natur.
"Die Menschen aus der Wildnis haben etwas gemeinsam: sie sind leise. Sie sprechen langsam und ruhig, mit wenig Scheu vor der Kamera. Wenn sie von ihrem Leben erzählen, schmunzeln sie manchmal, dann ist es ihnen ein bisschen peinlich, gefilmt zu werden. Doch die Ureinwohner und Eremiten in Elsewhere sind keine Misanthropen. Im Gegenteil, sie sprechen nur die behutsame Sprache der Natur." (Ninette Krüger)
am 28.01. (lange Nacht der Museen) und 02.02. jeweils um 19.00 Uhr
|