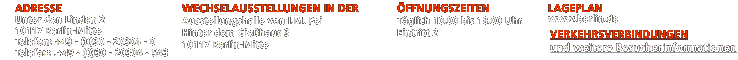|
Ein Interview mit dem Kurator der Ausstellung,
Herrn Dr. Rainer Rother

Kuator der Ausstellung Dr. Rainer Rother |
Museumspädagogik:
Welche Überlegungen stehen hinter den drei Leitbegriffen
der Ausstellung Erfahrung, Neuordnung und Erinnerung?
Dr. Rother: Das Konzept geht davon
aus, dass der Erste Weltkrieg mittlerweile in eine neue
Perspektive als der Beginn des „kurzen 20. Jahrhunderts“
gerückt ist, und dass sich deswegen seine Darstellung
geändert hat. Er ist nicht mehr völlig hinter
dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust verborgen, sondern
er ist der Beginn einer Epoche, von der wir sagen, sie
sei seit 1989 – oder 1992, was Russland betrifft
– beendet. Unsere Überlegung war, seine Folgen
ins Zentrum der Ausstellung zu stellen sowie diejenigen
Aspekte, die ihn zu einem modernen, teilweise totalen
Krieg gemacht haben. Es war das erste Mal, dass ganze
Gesellschaften und Ökonomien auf den Krieg ausgerichtet
wurden.
|
So haben wir uns entschlossen, den ersten
Teil Erfahrung zu nennen, um deutlich zu machen, dass es sich
nicht um eine militärhistorische Ausstellung handelt,
sondern dass der kulturhistorische Aspekt in den Vordergrund
gerückt wird.
Der zweite Punkt Neuordnung behandelt die Folgen des Ersten
Weltkrieges. Neuordnung ist ja ein relativ positiv besetzter
Begriff und positiv war auch die Absicht derjenigen, die diese
Neuordnung unter der Idee der nationalen Selbstbestimmung
gestaltet haben. Dass das in der Folge nicht immer funktioniert
hat, ist Thema dieses Ausstellungsteils. Für uns ist
aber auch entscheidend, dass dieser Erste Weltkrieg Folgen
für die Staatenwelt hatte, das betrifft vor allem Osteuropa.
Der letzte Teil Erinnerung versucht das Ereignis mit dem,
was in der Erinnerung aus ihm geworden ist, zu verknüpfen.
Dabei gibt es nationale Unterschiede nicht nur zwischen Sieger-
und Verliererstaaten, sondern auch zwischen West- und Osteuropa.
Woran erinnert man sich? Für die westlichen Alliierten
ist der 11. November der Tag der Erinnerung. In den Verliererstaaten
gibt es andere Tage, an denen der Toten gedacht wird: In Deutschland
den Heldengedenktag, seit den 1950er Jahren Volkstrauertag;
in Polen, Litauen, Estland und der Türkei den Unabhängigkeitstag.
Die Rede vom „Großen Krieg“ ergibt in Osteuropa
gar keinen Sinn, weil es für die ‚staatenlosen’
Polen, Litauer, Tschechen und Slowaken immer ein fremder Krieg
war. In Italien, Belgien, Frankreich und Großbritannien
ist die Chiffre „Großer Krieg“ immer noch
geläufig.
Museumspädagogik: Was ist für den
Ausstellungsbesucher interessant am Ersten Weltkrieg, warum
sollte er sich damit beschäftigen?
Dr. Rother: Der Erste Weltkrieg ist in gewisser
Hinsicht ein Epochenbruch, kein Zivilisationsbruch wie der
Zweite Weltkrieg und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft,
aber ein Bruch, der für ganz Europa extrem folgenreich
war. Er ist ein Bestandteil der Erklärung, warum es zum
Zweiten Weltkrieg kam. Einige der für die deutsche Geschichte
besonders verhängnisvollen Folgen des Erstes Weltkrieges
sind auch in anderen Staaten zu beobachten: der gewaltsame
Umgang mit politischen Gegnern und die Einteilung ganzer Nationen
in ein „Freund-Feind-Schema“. Europa ist unfähig,
dem eine Friedensordnung entgegenzusetzen. Es ist wichtig,
daran zu erinnern, wie Kriege entstehen und welche Folgen
sie haben, denn dieser Krieg war ein unnötiger.
Insofern wollen wir dazu anregen, die deutsche Geschichte
vollständiger zu begreifen. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
wäre es eine wünschenswerte Erkenntnis, dass eine
Aufteilung der Welt in Gut und Böse keinen Segen hat,
auch in Zukunft nicht.
Museumspädagogik: Welches ist Ihr persönliches
Lieblingsobjekt in der Ausstellung?
Dr. Rother: Möglicherweise das Triptychon
von Johannes Koelz – ein Objekt mit einer ungewöhnlichen
Geschichte, dessen wenige erhaltene Fragmente wir nach Berlin
bringen konnten. Koelz’ Werk erinnert in der Brutalität
der Darstellung dessen, was der Krieg wirklich ist, sehr an
Otto Dix.
Museumspädagogik: Eine Frage in Hinblick
auf die EU-Osterweiterung. Wird der Erste Weltkrieg jetzt
so etwas wie ein europäischer Erinnerungsort werden?
Dr. Rother: Ja, in gewisser Weise könnt
man sagen, dass der Beitritt dieser zehn Länder auch
eine Art Schlusspunkt hinter den Ersten Weltkrieg ist, denn
von ihnen sind fast alle nach 1918 entstanden. Insofern ist
der 1. Mai 2004, der Tag der EU-Erweiterung, tatsächlich
ein Tag, der formal und völkerrechtlich eine Neuordnung
in Europa realisiert. Das ist nicht nur eine Folge des Ersten
Weltkrieges, wie wir alle wissen, es hat auch sehr viel mit
der Überwindung der Folgen des Zweiten Weltkrieges zu
tun, aber für die Erinnerung in diesen Staaten ist das
schon ein sehr prägender Moment.
Das Interview führten Julia Hornig und Johanna
von Münchhausen, DHM-Museumspädagogik
|