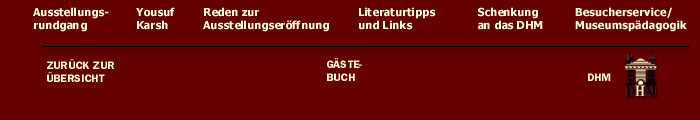|
ROSEMARY
DONEGAN
Karshs Industrieporträts
"... diesmal den arbeitenden Menschen verherrlichen"
Anfang der fünfziger Jahre begann Yousuf Karsh, der Meister der
Prominentenfotografie, eine neue Porträtserie - diesmal "zur Verherrlichung
des arbeitenden Menschen". Diese Porträts wurden - wie von Karsh
geplant - eindrucksvolle Bilder von "Menschen, die mit Leib und
Seele in der Industrie arbeiten"(1).
Die Fotografien - Auftragsarbeiten für eine Reihe von Industrieunternehmen
- waren Bestandteil eines breit gefächerten Werbetrends, der sich
in der traditionellen Verbraucher- und Händlerwerbung, aber auch
in Jahresberichten, Fotogeschichten in Zeitschriften sowie bei der
Organisation und Promotion von Fotoausstellungen auf Messen und
in öffentlichen Kunstgalerien niederschlug. Die neuartige Werbestrategie
entwickelte sich zu einer umfassenden Richtung nicht nur im Grafikdesign,
sondern die "Corporate Identity" - das Gesamtbild eines Unternehmens
in der Öffentlichkeit - rückte ins Rampenlicht des Interesses, wobei
auch die dazugehörigen ideologischen und politischen Aspekte einbezogen
werden.
Yousuf Karshs Industrieporträts aus den frühen fünfziger Jahren
zählen mit zu seinen eindrucksvollsten Arbeiten. Seine unverhohlene
ideologisch gefärbte Heldendarstellung des Arbeiters war als Phänomen
nicht neu. (Während des Kriegs erfreute sich das Arbeiterbild öffentlicher
Beliebtheit.) Karshs Industrieporträts zeichnen ein ausschließlich
positives Bild des Arbeiters und unterstützte auf diesem Wege den
Interessenkonflikt zwischen Unternehmer und Management auf der einen
Seite und Arbeiter und Gewerkschaft auf der anderen. Seine Fotografien
dienten auch der anti-kommunistischen Propaganda, die ein unübersehbares
Element der Eigenwerbung kanadischer Unternehmen war und zudem strategischer
Bestandteil eines seitens der Presse geschürten Kalten Kriegs zwischen
den Ideologien; der Kalte Krieg führte in ganz Kanada zu Polarisierung,
Spannungen und Ängsten.
Die komplexen Sinnebenen der Industriefotografie Karshs lassen sich
am Entstehungskontext und der wechselnden Würdigung als Bestandteil
seines Gesamtwerk ablesen. Sie sind auch heute, fünfzig Jahre später,
ein aufschlußreicher Beleg für Gewicht und Intensität seiner Arbeiterporträts.
Zum tieferen Verständnis der Industriearbeiten Yousuf Karshs lohnt
es sich, diese im Gesamtzusammenhang der sich entwickelnden Industriefotografie
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu betrachten.
Bilder aus der Arbeitswelt - von Maschinen, Fabriken und Industriearbeitern
- zählen zu den ersten Sujets der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts.
Auch in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ließen sich
die Fotografen von körperlicher Arbeit, Geschwindigkeit und Maschinenkraft
faszinieren. Dabei benutzten sie die Fotografie besonders, um die
Monumentalität des Arbeitsprozesses einzufangen. Die Industriefotografie
existiert zwischen zwei Polen. Einerseits hat sie starke Wurzeln
in der sozialen Dokumentation der Arbeit und Industriewelt und ist
von daher kritisch orientiert. Andererseits liefert sie ästhetisierende
Bilder von Macht und Schönheit der Maschinen und der Industrie,
die positivistisch und verkaufsfördernd wirken.
Wir finden diese kontradiktorischen Impulse in den Bildern amerikanischer
Fotografen wie Lewis Hine (1874-1940) wieder, dessen frühe Dokumentation
von Kinderarbeit schärfste Kritik beinhaltete - wohingegen seine
späteren Darstellungen von Mensch und Maschine, besonders vom Bau
des Empire State Buildings, zu ästhetischen Symbolen des amerikanischen
städtischen Industrielebens wurden. Spätere Industriefotografen
wie Charles Sheeler (1883-1965) mit seiner Serie über Henry Fords
neuer River Rouge Automobilfabrik und Margaret Bourke-White (1904-1971),
die in ihrer langen Karriere als Fotojournalistin die nordamerikanische
und sowjetrepublikanische Industriemacht im Bild festhielt, benutzen
Maschinen als formal ästhetische Requisiten im Schauspiel des industriellen
Prozesses.
Die Industriefotografie in Europa dagegen, besonders in Deutschland
zwischen den Weltkriegen, beschäftigte sich eher mit Idee und Kontroversen
des Modernismus.(2)
Die technisch orientierten Fotografien Albert Renger-Patzschs (1897-1960)
in seiner Serie "Die Welt ist schön" (1927) zeigen Maschinenbilder
von großer Klarheit und Detailtreue, unbehelligt vom menschlichen
Eingriff. Renger-Patzsch war ein Vertreter der Neuen Sachlichkeit,
die auf eine objektive Wiedergabe der Welt, einen sachlichen Realismus
abzielte. Germaine Krull (1897-1985), in Deutschland geboren, kam
im Paris der zwanziger und dreißiger Jahre in Kontakt mit der Foto-Avantgarde.
Ihr Portfolio "Métal" (1927), mit Fotografien von Strukturen und
maschinell gefertigten Gegenständen, enthält Kompositionen aus Texturen
und Formen als abstrakte technische Bilder.
 |
|
Auszüge
aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung - "YOSUF
KARSH - Helden aus Licht und Schatten",
mit freundlicher Genehmigung des G+H Verlages, Berlin.
|
In Kanada beschränkte sich die Industriefotografie auf eine Handvoll
unabhängiger Fotografen, die in Camera Clubs und Foto-Salons ausstellten
- unter ihnen Grant Gates in Hamilton sowie John Vanderpant und
James Crookall in Vancouver.(3)
Zudem existierte eine starke Tradition der Fotodokumentation wichtiger
öffentlicher Projekte wie Straßen- und Brückenbau oder gigantische
Wasserbauprojekte. Auch soziale Einrichtungen benutzten die Fotografie
gelegentlich zu Dokumentationszwecken. Während des Kriegs wurden
viele Industrieanlagen aus Gründen nationaler Sicherheit fotografisch
registriert.
Das Bild des Arbeiters wurde während des Ersten Weltkriegs zum Bestandteil
industrieller Selbstdarstellung; gleichzeitig war sein Bild unerläßlicher
Bestandteil des Propagandakriegs in der Heimat - "War at home" -
und wurde zum zentralen Erfolgssymbol während der Kampagne zum Kauf
von Kriegsanleihen.(4)
Im Zweiten Weltkrieg steigerte sich diese Regierungspropaganda:
Anzeigentafeln, Aktionen zur Kriegsanleihe, Wochenschauen, Plakate
und privat finanzierte Annoncen spielten eine wesentliche Rolle
bei der Schaffung eines ideologischen Hintergrunds für den Kriegseinsatz
der Allierten. Wieder war der Arbeiter in der Bildersprache militärischer
Siegesposen ein geschätzter Partizipant des "War at home". Er wurde
zum Symbol einer demokratischen Zivilgesellschaft, in der er einen
produktiven und stolzen Beitrag zum Schutz der Demokratie leistete.
Dieser zwingende Symbolismus fand seinen Niederschlag auch in Plakaten
und Filmen des Canadian Wartime Information Board (NFB) unter der
Regie von Harry Mayerovitch.(5)
Auch in den traditionellen Bildenden Künsten - Malerei und Bildhauerei
- entstanden zwischen 1942 und 1945 eine beträchtliche Anzahl Werke,
in denen die Bildersprache der Kriegsindustrie ihren Ausdruck fand.
Dabei handelte es sich um Arbeiten politisch aktiver Künstler, die
die Industriearbeit und dabei besonders die Frauenarbeit dokumentierten.
Interessanterweise konzentrierten sich diese Bilder - Fotografien
und Gemälde - selten auf das Individuum.
Auffällig bei der Industriefotografie war, wie komplex sich die
fotografischen Möglichkeiten und Absichten seitens des Fotografen
und des Kundens gestalteten - egal, ob es sich um ein Unternehmen,
eine öffentliche Einrichtung oder einen unabhängigen Auftrag für
eine Veröffentlichung oder Ausstellung handelte. Öffentliches Forum
für die neue Industriefotografie waren die neuen Bildzeitschriften,
zuerst Fortune, später Life und Look in den Vereinigten Staaten,
in Deutschland und Frankreich Berliner Illustrirte Zeitung, Vu und
Voilà. Dabei fand die Industriefotografie, der man im Fotojournalismus,
in Filmen und Fotobänden begegnete, als Kunstform und kommerzielles
Instrument weitreichende Beachtung.
Seit 1930 wurde die Industriefotografie zunehmend von Großunternehmen
zu Werbezwecken eingesetzt; die Investoreninformation spielte dabei
keine geringe Rolle - besonders bei der Präsentation des jährlichen
Rechenschaftsberichts, mit dem die Anteilhaber vom Stand der Investitionen
unterrichtet wurden. Dabei handelte es sich für gewöhnlich um eine
vier bis sechsseitige Broschüre mit rechtsverbindlicher Finanzstatistik,
Anmerkungen und Anschreiben der Unternehmensleitung. Dies änderte
sich Ende der vierziger Jahre dahingehend, daß der Jahresbericht
um Informationen über Unternehmensaktivitäten, Unternehmensgeschichte,
Zukunftspläne, Belegschaft, Erläuterungen zu Produkten und Dienstleistungen
etc. angereichert wurde. Der neue Jahresrechenschaftsbericht wurde
sorgfältig geplant und entworfen, wie dessen Typografie, Tabellen,
Diagramme, Zweifarb-Einband, Schwarz-weiß-Fotos und Papierqualität
bezeugen.(6)
Das Stahlwerk "Atlas Steel"
Im April 1950 bot A. Earle Higgins, Abteilungsleiter bei Charles
Francis Press Inc. - einem großen New Yorker Druckereibetrieb -
Yousuf Karsh einen Auftrag als Fotograf für Atlas Steel in Welland,
Ontario an. Higgins war der Direktor der neu geschaffenen Werbeabteilung,
die komplette Public Relations-Kampagnen konzipierte und Kunden
ihre Dienste auch bei der Herstellung von Rechenschaftsberichten
anbot - und zwar im Bereich von Planung, Forschung, Formulierung,
Layout, künstlerische Gestaltung und natürlich Vervielfältigung.
Die Abteilung produzierte zudem Werbematerial, Zeitschriften und
Firmenzeitungen. Higgins jüngste Innovation waren Aufträge an Künstler,
Firmengebäude in Öl zu malen; diese Gemälde wurden dann in den Jahresberichten
abgedruckt.(7)
Atlas Steel war ein Stahlwerk in Welland, Ontario mit über 2.000
Arbeitern und einer komplizierten Arbeiter/Management-Beziehung.
Welland, am Erie Canal gelegen, hatte sich um die Wende zum 20.
Jahrhundert zum Zentrum der Stahl- und Kleinindustrie entwickelt,
weil die nahegelegenen Niagara-Fälle billige Elektrizität lieferten.
Unter Roy H. Davis 1928 zum Konzern zusammengeschlossen, spezialisierte
sich Atlas auf Fein- und Spezialstahl für Bergbau und Werkzeug.
Während des Zweiten Weltkriegs expandierte das Werk und baute sechs
Herould Schmelzöfen, um mit Regierungszuschüssen Stahl für Gewehrkolben
des Maschinengewehrherstellers Bren & Browning zu gießen. 1941 versuchte
die Gewerkschaft United Steelworkers und 1943 die United Electrical
Workers (UE), die Arbeiterschaft des Konzerns gewerkschaftlich zu
organisieren. R. H. Davis zögerte nicht, die UE zu drangsalieren
und einzuschüchtern.(8)
1949 wurde der
erste Tarifvertrag der "unabhängigen" Unternehmensgewerkschaft von
einer knappen Mehrheit der Beschäftigten akzeptiert.
Im April 1950 baute Atlas ein neues Walzwerk für Edelstahl, das
erste in Kanada. Ursprünglich lautete Karshs Auftrag im gleichen
Jahr, sechs Schwarz-weiß-Porträts von "schwitzenden Stahlarbeitern...
möglichst authentisch...Hochöfen, etc."(9)
zu liefern. Karsh reagierte begeistert und betonte sein besonderes
Interesse an den Arbeitern - er wolle "diesmal den arbeitenden Menschen
verherrlichen"(10).
Der Fototermin bei Atlas Steel wurde ein ausgesprochener Erfolg.
Karsh arbeitete, assistiert von Monty Everett, eine Woche lang mit
seiner Frau Solange vor Ort. Er wählte selbst die Männer für die
Fotos aus, und das Unternehmen unterstützte ihn in jeder Hinsicht.
1951 erhielt Karsh einen Folgeauftrag von Atlas Steel; diesmal ging
es darum, all jene Beschäftigten abzulichten, die seit langem zur
Belegschaft zählten. Zwischen den Karshs, Roy und Sally Davis und
deren Tochter Debbie entwickelte sich eine intensive Freundschaft.
Das Projekt fand diesmal in besonders wohlwollender Atmosphäre statt.
Davon zeugt ein herzlicher, überschwenglicher Briefwechsel. Geschenke
wurden ausgetauscht und Sally Davis schenkte Solange Karsh diverse
Küchenutensilien aus Edelstahl.
 |
|
Auszüge
aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung - "YOSUF
KARSH - Helden aus Licht und Schatten",
mit freundlicher Genehmigung des G+H Verlages, Berlin.
|
Auf dem Umschlag des Atlas Steel-Rechenschaftsberichts prangt 1950
eine bemerkenswerte Fotografie: Aus einer riesigen Gießpfanne fließt
im Sonnenlicht flüssiger Stahl in die Form, signiert: "Karsh of
Ottawa". Der Begleittext berichtet von der Entwicklung der neuen
Edelstahlfabrik und einer fünfjährigen Werbekampagne, in der die
kanadische Öffentlichkeit mit den positiven Eigenschaften des neuen
Materials vertraut gemacht werden soll. In diesem Bericht gibt es
auch einen kurzen Passus über Karsh und seinen Porträtauftrag "Männer
machen Atlas Steel", dazu ein Abschnitt über "Die Wiederbewaffnung
Kanadas, die steigenden Kosten von Arbeitskraft und Rohmaterialien".
Der letzte Abschnitt trägt den Titel "Kanada den Kanadiern verkaufen"
und beschreibt die Anzeigen-Kampagne des Konzerns in kanadischen
Verbraucherzeitschriften, bei der kanadisches Wirtschaftswachstum
und -potential im Mittelpunkt stehen. Im letzten Abschnitt des Jahresberichts
heißt es dann: "Unser Glaube an den kanadischen Way of Life, eine
blühende kanadische Zukunft und unser Selbstvertrauen sind in dieser
Periode unserer Landesgeschichte besonders gefragt, in der alle
uns kostbaren Errungenschaften von den Mächten des Kommunismus bedroht
sind. Diese Bedrohung existiert nicht in weiter Ferne, sondern vor
unserer Haustür, sie hat selbst bei den Erben der kanadischen Tradition
nicht Halt gemacht. Wir glauben, daß die Industrie gegenüber der
Nation verpflichtet ist, sich dem Kampf um den Erhalt unserer Institutionen
direkt anzuschließen. Die Anzeigenkampagne ist nur ein Weg, den
wir in diesem Kampf gewählt haben."(11)
Im Jahresbericht selbst befanden sich zwei Fotos von Karsh. Das
erste, Strangzieher im Südwerk, sprüht geradezu vor Dynamik: Rotglühende
Stahlstränge werden bei der Herstellung von Edelstahl zu fertigen
Stangen gezogen. Das einzige abgebildete Porträt von Karsh zeigt
George Guglielmo, einen Walzarbeiter an der 1.000 Tonnen-Presse
(Abb. 129, vgl. Abb. 135). Der Medienverlautbarung zufolge, die
sich auf Solange Karshs Notizen stützte, war Guglielmo ein fünfundzwanzigjähriger
Kanadier italienischer Abstammung und verlobt mit der Kanadierin
Anne Amantia (ebenfalls italienischer Herkunft). Der Pressetext
lautete: "George und Anne sehen in eine strahlende Zukunft. Seine
Zukunft als Stahlwerker ist gesichert und beide lieben das Land,
in dem ihre Träume wahr werden."(12)
Das Porträt von Guglielmo trägt den Titel Atlas Steel (Lancelot)
und läßt den jungen Walzarbeiter mit hochgeschobenem Gesichtsschutz
direkt in die Kamera blicken; der Stahlhaken in seiner behandschuhten
Hand gleicht einem mittelalterlichen Krummstab. Guglielmo strahlt
in seiner offenen Ernsthaftigkeit eine entwaffnende, fast naive
Direktheit aus; der Lichtkreis hinter ihm wird zum Heiligenschein
und läßt den Betrachter unwillkürlich an einen christlichen Hirten
denken. Bei exakter Betrachtung zeigt sich, daß dieses Foto aus
zwei Negativen entstanden ist: dem der sorgfältig ausgeleuchteten
Person und dem der riesigen Stahlpresse, in der Stahl zu Barren
und Blechen verarbeitet wird.(13)
Karsh hatte freie Hand bei der Auswahl seiner Motive und wählte
deshalb Männer mit einprägsamen Gesichtszügen. ›Zwei Stahlarbeiter‹
zeigt beispielhaft, wie Karsh die Industriewelt durch indirektes
Licht und große Tiefenschärfe dramatisch in Szene setzte. Auch hier
arbeitete er mit multiplen Negativen (Abb. 130, vgl. Abb. 136) Das
Gesicht der Figur im Vordergrund wird vom Flutlicht ausgeleuchtet,
wobei besonders die Schatten um Augen und Hals hervortreten. Die
Gläser der hochgeschobenen Schutzbrille sitzen wie Hörner auf der
Stirn und geben dem Gesicht einen diabolischen Anschein. Das Satanische
der Gesamtszenerie wird durch die geschmeidige Silhouette im Hintergrund
gesteigert, die einen dramatischen, vom Funkenflug kunstvoll beleuchteten
Kontrast zum aggressiven Gesicht und Körper im Vordergrund bildet.
Der Jahresbericht von 1951 wurde mit zwei Fotos von Karsh ausgestattet;
das dynamische Titelbild der stromlinienförmigen Innenarchitektur
aus Edelstahl eines Ladens ist allerdings nicht von Karsh. Der Text
des Jahresberichts klingt diesmal weit weniger politisch und informiert
über die Verdreifachung der Gewinne 1951 durch die Umsatzerfolge
der erst zweijährigen Edelstahlproduktion. Atlas befand sich wie
viele andere kanadische Unternehmen mitten im Wirtschaftswunder.
Wie die Zeitschrift Fortune 1951 feststellte, war Wohlstand ins
kanadische Leben eingekehrt. Die Wiederbewaffnung im Koreakrieg
bedeutete Umsatzsteigerungen auf vielen Ebenen.
(14)
Eine Fotoserie zeigt die aus Atlas Stahl hergestellte Produktpalette
von Einrichtungen aus der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie,
Krankenhauseinrichtungen, Auspuffrohren über Grillgeräte bis hin
zu Töpfen und Pfannen.
Der von Higgins organisierte Werbefeldzug für Atlas Steel verfehlte
seine Wirkung nicht. Zum Gesamtprojekt gehörten letztendlich Abbildungen
in zwei Jahresberichten, sechs Fotografien für den Atlas Steel Kalender
1952, Ausstellungen in der Charles Francis Press Gallery in New
York, im Royal York Hotel in Toronto und später in der MIT Gallery,
Boston.(15))
Obendrein erhielten die Ehefrauen aller von Karsh porträtierten
Angestellten und Arbeiter ein Originalporträt ihrer Männer.(16)
Atlas Steel Fotografien wurden in Lokalzeitungen und diversen internationalen
Magazinen abgedruckt (Fortune, Dez. 1950; Saturday Night, 24. Okt.
1950; Die Woche, Neue Illustrierte Zeitung, 19. Aug. 1951). Die
Fotoserie "Männer machen Atlas Stahl" und die dazugehörigen Entwürfe
wurden in Zeitschriften mit einer Gesamtauflage von über 16 Millionen
gezeigt.(17)
Für Atlas Steel war das Projekt ein großer Erfolg, sowohl intern
als auch nach außen als Werbestrategie. Wie einer der Vorstandsmitglieder
1951 kommentierte: "Die Ausstellung der Porträtserie ›Männer machen
Atlas Stahl‹ von Yousuf Karsh ist wichtiger Bestandteil eines breit
angelegten Programms, das der Öffentlichkeitsarbeit genau so wie
der Förderung des Arbeitsklimas dient. Die vielen Einsatzmöglichkeiten
der Fotos haben die Firmenspitze bei der Lösung komplizierter Probleme
effektiv unterstützt."(18)
 |
|
Auszüge
aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung - "YOSUF
KARSH - Helden aus Licht und Schatten",
mit freundlicher Genehmigung des G+H Verlages, Berlin.
|
Ford Kanada
Im Anschluß an den Atlas Steel-Jahresbericht 1950 erhielt Karsh
einen weiteres Industrieangebot - und zwar von Ford Kanada in Windsor.(19)
Im November 1950 beauftragte Gordon Garbutt, der Werbemanager der
Ford Automobilwerke in Kanada, Yousuf Karsh, auch für den Jahresbericht
1950 für Ford tätig zu werden. Garbutt skizzierte die Werbestrategie
des Ford Konzerns 1950 folgendermaßen: "Ford Kanada besteht nicht
aus Gebäuden, Maschinen, Fließbändern, Teststrecken, Automobilen
und Elektrizitätswerken, sondern aus Menschen. Die Hände der Handwerker,
der Lichtschimmer eines Metallkessels, der sich im Gesicht des Gießers
spiegelt, die sehnigen Arme eines Kranführers - dies alles sind
wesentlichere Symbole unserer Industrie als Stahl oder Backstein
oder Holz."(20)
Higgins, der auch bei den Verhandlungen mit Ford eine unerläßliche
Rolle spielte, sah den Vertrag als Vorboten neuer Aufgaben für das
Ford-Hauptwerk in Detroit. Er stellte fest: "Zuviele der beteiligten
Elemente ... weisen eindeutig in diese Richtung. Vom amerikanischen
Standpunkt ist es insgesamt wesentlich, daß dieses Projekt über
Ford Kanada hinausreicht. Zur Zeit ist man mit einem beträchtlichen
Verteidigungsprojekt beschäftigt, das vom Public Relations Standpunkt
besondere Aufmerksamkeit erfordert. Vergessen Sie nicht, dies ist
das größte Projekt, das Ford Kanada je in Angriff genommen hat,
und nichts darf schief gehen."(21)
Higgins konnte einen für die frühen fünfziger Jahre exzellenten
Vertrag aushandeln. Karsh erhielt für das zweiwöchige Projekt $10.000,
von denen Higgins 25% bekam. Der Stundenlohn der Männer, die Karsh
bei Ford fotografierte, betrug damals durchschnittlich $1.33, der
Jahreslohn $2,750.00.(22)
Der Auftrag der Ford Werke kam mitten im Kalten Krieg, während die
internationalen Spannungen wuchsen und der Beginn des Korea Kriegs
im Sommer 1950 die Furcht vor dem Dritten Weltkrieg schürte. In
Kanada betrieb der Ford Konzern eine wahre Ideologieschlacht gegen
den Kommunismus. Rhys Sale, der kanadische Direktor, hielt im Januar
1951 eine Rede mit dem Titel: "Rechtzeitig die mächtige Bedrohung
durch den Kommunismus eindämmen"(23).
In ganz Kanada forderten Arbeiter und Gewerkschaften - nach der
Depression der dreißiger Jahre und dem festgeschriebenen Lohn-Preisniveau
des Zweiten Weltkriegs - erstmals Lohnerhöhungen und Zusatzleistungen.
Auch in Windsor herrschte Krisenstimmung; die Beziehung zwischen
der Ford Betriebsleitung und der Gewerkschaft United Automobile
Workers (UAW) war konfliktreich. Die Gewerkschafter hatten bereits
Ende 1945 nach einem 99-Tage-Streik einen Sieg für die organisierte
Arbeiterschaft errungen.(24)
Inzwischen wurden die Gewerkschaften besonders durch die heimgekehrten
Veteranen gestärkt, die auch vermehrt zusätzliche Sozialleistungen
forderten. Die Spannungen des Kalten Kriegs waren auch in der Arbeiterschaft
spürbar, und eindeutig kommunistisch orientierte Gewerkschaften
wie die UE und die Mine, Mill und Smelter Workers Union (Bergbau,
Stahl und Eisenverhüttung) in Sudbury wurden gegen die United Steelworkers'
of America ausgespielt. Zusätzlich loderten in der UAW politische
Flügelkämpfe zwischen kommunistisch und vereinzelt militant orientierten
Linken und Anhängern der eher sozialdemokratisch orientierten Partei
CCF.(25)
Dementsprechend war die innerbetriebliche Lage bei Ford, als Karsh
die Szene betrat. Die Atmosphäre war angespannt und hektisch, teils
auch aufgrund des enormen Zeitdrucks, unter dem der Ford-Jahresbericht
1950 enstand. Zusätzlich traten beim Fotografieren in den unübersichtlichen,
lauten, schmutzigen Werkhallen, deren Beleuchtung sich schwierig
gestaltete, vermehrt Komplikationen auf. Besonders die intensiven
Fließbandaktivitäten ließen sich nur mühsam fotografisch festhalten.
Gelegentlich schienen Karsh die Probleme über den Kopf zu wachsen.(26)
Karsh stellte auch bei dieser Porträtserie erneut den Menschen in
den Mittelpunkt, wie er in einem Interview erklärte: "Es geht nicht
um die Große Maschine. Hier entsteht eine Porträtserie über Arbeiter
- die Arbeiter bei Ford. Sie sind kein Teil der Großen Maschine.
Sie erwecken die Große Maschine zum Leben. Wichtig ist der Mensch,
die Tätigkeit ist sekundär. Tätigkeit und Maschinerie vermitteln
die Atmosphäre - sie bilden den Hintergrund."(27)
In einer Presseverlautbarung kommentierte er: "Ich fange mit der
Kamera Impressionen ein. Ich porträtiere den Stolz der Arbeiter
auf ihr Können, und die Unabhängigkeit der Arbeiter in einer Demokratie.
Beim Automobilbau ist Teamarbeit ein wesentlicher Faktor. Ich möchte,
daß sich in diesen Porträts das Bewußtsein der Angestellten spiegelt,
die im Team eine verantwortungsvolle Rolle spielen." (28)
Interessant ist, daß alle von Karsh fotografierten Männer von der
Personalabteilung als "charakterlich gut" eingestuft waren. Der
Jahresbericht von Ford Kanada 1950 enthielt sechs Karsh Porträts
der Serie "Die Männer von Ford Kanada", dazu kurze aber dramatische
Tätigkeitsbeschreibungen. Dem Foto von Gerald Bruner mit dem Titel
Partner ist folgender Kommentar beigegeben: "Automatische Maschinen
symbolisieren mit ihrer Präzision und Kraft die Automobilproduktion;
aufmerksame, fähige Männer geben diesen Maschinen Leben und Sinn."(29)
Karshs Ford-Porträts sind klassische Beispiele seines berühmten
Stils: Sie wirken in ihrer indirekten Beleuchtung und dramatischen
Gestaltung intensiv und theatralisch. Die Serien halten drei wesentliche
Männertypen im Bild fest: ruppige ältere Arbeiter, die er warmherzig
und umgänglich darstellt; junge Wissenschaftler und Manager als
nüchterne und ernste Kapital- und Techologievertreter; außerdem
jungen Arbeiter - hübsche Muskelmänner, die zuversichtlich in die
Kamera blicken (Abb. 131, 132).
Die Arbeiter Terry Wasyke und Morris Lehoux posieren in ihrem Doppelporträt
bühnen-, wenn nicht filmreif (Abb. 137). Der eine sieht tief in
die Augen des anderen, wobei dieser andere dem Blick ausweicht und
eine eigentümliche zwischenmenschliche Spannung erzeugt. Die in
der Lackiererei benutzten Schutzanzüge geben den beiden in der oberen
linken Bildhälfte in Szene gesetzten Autolackierern etwas Bizarres.
Bei dem Porträt Gow Crapper, Fertigungsstraße I greift Karsh allerdings
nicht auf sein gewohntes Repertoire von Posen und Formen zurück
(Abb. 133, vgl. Abb. 138). Das exakt strukturierte Bild zeigt einen
jungen Mann, umrahmt von einem Wagenrückfenster, durch das er beim
Zusammenbau vom Fließband aus in die Kamera blickt. Der junge Mann
- Solange Karsh hält ihn in ihren Notizen für einen "netten Kerl"
- war verheiratet, hatte ein Kind und spielte in der Essex Scottish
Regiment Bugle Band.(30)
Obwohl diese Porträts aufgenommen wurden, bevor in den späten fünfziger
Jahren die Kultfigur des amerikanischen Arbeiter-Antihelden kreiert
wurde, besitzen die Dargestellten die erotische Ausstrahlung eines
James Dean oder Marlon Brando. Heute, im 21. Jahrhundert, hat das
Männerbild jener Tage für seine Betrachter auch eindeutig stereotype
homoerotische Züge. Interessanterweise wurden die Fotografien der
jüngeren Männer von Ford Kanada weder 1950 noch 1951 im Jahresbericht
abgedruckt, sondern lediglich die der älteren und gutgelaunten.
Siebenundzwanzig der Ford-Porträts wurden im August 1951 im CNE
in Toronto gezeigt; zur Ausstellung erschien eine 16-seitige Broschüre
"The Men of Ford of Canada". Die Ausstellung war in zehn Städten
der Provinzen Ontario, Quebec und der Küstenprovinzen zu sehen,
außerdem im November 1951 in der Willistead Art Gallery in Windsor.
Inzwischen war das Verhältnis zwischen der Ford-Unternehmensleitung
und seiner Arbeiterschaft angeschlagen. Am 31. Oktober 1951 hatte
das Unternehmen die Eröffnung eines neuen Werks in Oakville bei
Toronto und die Verlagerung der Endmontage angekündigt. Vom 3. bis
14. Dezember erlebte Ford Kanada einem dramatischen wilden Streik
- eine von vierunddreißig Arbeitsniederlegungen in wenigen Wochen.(31)
 |
|
Auszüge
aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung - "YOSUF
KARSH - Helden aus Licht und Schatten",
mit freundlicher Genehmigung des G+H Verlages, Berlin.
|
Andere Industrieprojekte
Natürlich war Karsh weiterhin an Porträtaufträgen aus der Industrie
interessiert. 1952 empfahl er - erfolglos - dem Unternehmen Willys
Overland eine Erweiterung seiner Werbekampagne für den neuen Aero
Willys Personenwagen um eine Industrie-Porträtserie.(32)
In den späten fünfziger Jahren fertigte er eine Reihe Industrieporträts
für Sharon Steel in Sharon, Pennsylvania, wobei es sich hauptsächlich
um Aufnahmen für die Unternehmenswerbung handelte. Karsh konnte
seine Motive nicht selbst auswählen, weil das Layout der Anzeigen
vorgegeben war.(33)
Bei diesen Fotografien griff er auf seine Kenntnis der klassischen
Hintergrundbeleuchtung zurück, setzte die Person, deren Negativ
er dann beschnitt, in den Vordergrund und konstruierte einen detaillierten
Hintergrund aus multiplen Negativen. Die Aufnahmen wirken insgesamt
steif und gestellt. Offenbar gab es zwischen Karsh und seinen Modellen
wenig Gemeinsamkeiten, und manche der Manager wirken geradezu erstarrt.
Einer der "seltenen Ausflüge Karshs in die kommerzielle Werbung"(34)
- vergleichbar mit den Atlas und Ford Projekten - war 1955 sein
Auftrag für das Unternehmen Canadair Ltd., Montreal, das Überschallkampfflugzeuge
und Bomber, Überschall-Lenkraketen und eine breite Palette nuklearer
Flugzeugausrüstungen herstellte.(35)
Jede Anzeige der geplanten Kampagne sollte sich auf spezielle Themen
des Kalten Kriegs konzentrieren - die angebliche kommunistische
Unterwanderung der Bildung und Erziehung, die Leistungen kommunistischer
Sportler und die paranoide Vorstellung einer drohenden Weltrevolution
"Die Weltrevolution lebt"(36)
(Abb. 134). Yousuf und Solange Karsh waren an der Auswahl der Themen
beteiligt; die Wahl der Aufnahmeorte und Sujets war ihnen allein
überlassen. Der später die Fotos ergänzende Anzeigentext beschwor
den Charakter der Bedrohung, deren besonderen Bezug zu Kanada, und
das Gebot physischer und moralischer Wachsamkeit - ein Beispiel:
"Junge Männer! Dient eurem Land jetzt in der Luftwaffe/Armee/Marine!"
Die Tatsache, daß Canadair Ltd. Großaufträge für F-68-Jäger und
sonstiges militärisches Gerät erfüllte, war sicher nicht unbedeutend
bei dieser Werbekampagne: "Dem Kommunismus Einhalt bieten - und
die Verteidigung stärken."(37)
Schlußfolgerungen
Yousuf Karsh definierte und porträtierte sich immer als Künstler
und verglich sich dabei mit Zeitgenossen wie Picasso und Rouault.
In vieler Hinsicht bewegte er sich jedoch außerhalb der künstlerisch
aufgeklärten Moderne. Seine Parteinahme für einen Humanismus, der
den Menschen als zentrale Figur sah, ist - besonders bei den Industrieporträts
- den internationalen Strömungen moderner Industriefotografie in
den fünfziger Jahren eigentümlich fern. Zu den Leitmotiven der Moderne
gehörte die Ästhetisierung von Maschine und Produktion. Fabrikarbeit
und Industrie waren wesentliche Ikonen des Maschinenzeitalters;
Schönheit der Form, Farbe und Struktur standen im Vordergrund; Überdimensionalität
symbolisierte Industriemacht.
Karsh nahm, vielleicht naiverweise, weder an den Industriedarstellungen
der Moderne bewußt Anteil, noch schienen sie ihn zu interessieren.
Seine Konzentration auf das Individuum, den Star, oder in diesem
Fall, den Arbeiter als Industriearistokraten, war für die fünfziger
Jahre eigentlich ungewöhnlich. Für Karsh stand die Maschine im Hintergrund,
in den Vordergrund stellte er den Menschen. So umging er die Maschine
als wesentlichen Faktor der Industrieproduktion und suchte in seinen
Porträts "Männer, die mit Leib und Seele in einer freien Wirtschaft
und einem demokratischen Staatssystem arbeiten"(38).
Im Kontext des Kalten Kriegs, seinen Konflikten und seiner Propaganda,
bekamen Karshs Fotografien - mit ihren religiösen Färbungen, erotischen
Anspielungen und humanistischen Absichten - einen unangenehmen Beigeschmack.
Karshs Absicht, den Arbeiter als Helden zu feiern, geriet durch
seine Parteinahme für die Industrieunternehmer des Kalten Kriegs
zur politischen Waffe gegen eben die Männer, die er ursprünglich
durch seine Arbeit würdigen wollte.
 |
|
Auszüge
aus dem gleichnamigen Katalog zur Ausstellung - "YOSUF
KARSH - Helden aus Licht und Schatten",
mit freundlicher Genehmigung des G+H Verlages, Berlin.
|
(1)
Atlas Steel Presseerklärung, 1952, Yousuf Karsh Fonds, Vol. 29,
National Archives of Canada, Ottawa.
(2)
Siehe John Stromberg, A ›United States of the World‹: Industry and
Photography between the Wars, in Kim Sichel, From Icon to Irony:
German and American Industrial Photography, Boston 1995, S. 17-45.
(3)
Siehe Rosemary Donegan, Industrial Images/ Images Industrielles,
Hamilton 1988, S. 62f., 95-97ff.
(4)
Ebenda, S. 24-30, 48-50, 114.
(5)
Siehe Harry Mayerovitch Collection, NAC 1998-024 and MG 30 D 400.
(6)
Der "New Look" zeigte sich in der Nachkriegszeit in Mode, Architektur
und Grafikdesign.
(7)
Charles Francis Press, Inc., Presseerklärung, Karsh Fonds R 613.
Vol. 29.
(8)
Die Angestellten von Atlas Steel hatten bis 1956 eine unternehmenseigene
Gewerkschaft. Nach dem Tod des ersten Direktors Roy Davis waren
auch die United Steelworkers of America im Werk vertreten. 1962
wurde der Konzern von Rio Algoma mines übernommen. Siehe Fern A.
Sayles, Welland Workers make History, 1963, und Atlas Steel Report,
1956.
(9)
Higgins an Karsh, 28. April 1950, Karsh Fonds, R 613, Vol. 30.
(10)
Karsh an Higgins, ebenda.
(11)
Atlas Steel Jahresbericht, 1950, S. 15f.
(12)
Karsh Fonds, R 613, Vol. 29.
(13)
Zum Nachlaß Yousuf Karsh gehören auch Fotografien und Negative,
darunter zahlreiche Beispiele der Sandwich-Technik. Diese Methode
wurde nicht nur von Karsh angewandt; die von ihm so hergestellten
Bilder sind nie besonders disktutiert worden. Siehe Karsh Fonds,
R 613, Vol. 30.
(14)
Comfortable Canada, Along with a Little Rearmament, Business-better-than-usual,
Fortune, Dez. 1950, S. 72ff.
(15)
Presseerklärung, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302.
(16)
Evening Tribune (Welland), 20. Dez. 1951, ebenda.
(17)
Ebenda.
(18)
Ebenda.
(19)
Zu Karshs Strategie als Berufsfotograf gehörte es, daß ein Projekt
gleichzeitig Werbung für einen Folgeauftrag war - er besaß einen
ausgeprägten Geschäftssinn, der ihn von freien Fotografen unterschied.
(20)
Garbutt an Karsh, 23. Nov. 1950, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302.
(21)
Telefonnotizen, Higgins an Solange Karsh, 1. Feb. 1951, ebenda.
(22)
Die Höhe der ursprünglichen Honorarforderung ist unklar, später
einigte man sich auf $10.000. Die Zahlen des jährlichen Durchschnittseinkommens
bei Ford sind dem Annual Report 1950, S. 18 entnommen, ebenda.
(23)
Text einer Rede vom 15. Jan. 1951, ibid.
(24)
Der Richter Ivan Rand legte mit seinem Urteil die Grundlagen dessen,
was als Rand Formula in die kanadische Gewerksschaftsgeschichte
einging. Er entschied, daß ein Angestellter, der von Gewerkschaftsverhandlungen
profitierte, auch wenn er kein Mitglied ist, Gewerkschaftsbeiträge
zahlen müsse. Er entschied obendrein, daß eine Gewerkschaft für
die Disziplin ihrer Mitglieder und generell für deren Verhalten
verantwortlich sei. Das Rand Formula wurde in Nordamerika durchgesetzt,
war um 1950 die Basis relativ stabiler Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeziehungen
und Grundlage der Lohnpolitik. Siehe Charlotte A. B. Yates, From
Plant to Politics: The Autoworkers Union in Postwar Canada, Philadelphia
1993, Kap. 3.
(25)
The CCF war die 1933 gegründete linksgerichtete, sozialdemokratische
Partei. Siehe Yates, ebenda, S.
(26)
Karsh
an Garbutt, 25. Feb. 1951, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302.
(27) "Karsh,
the Philosopher Pictures Ford Workers", Windsor Star, 13. Feb. 1951.
(28) Ford
of Canada Presseerklärung, 7. April 1951, und Ford Graphic, April
1951, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302
(29) Ford
of Canada, Jahresbericht, 1950.
(30)Handschriftliche
Notizen von Solange Karsh, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302.
(31) Yates,
ebenda, S. 84.
(32) Karsh
an W. Canaday, Direktor von Willys Overland, 2. Mai 1952, Karsh
Fonds, R 613, Vol. 47.
(33) Ebenda,
Vol. 55.
(34)
Zahlreiche Presseerklärungen betonen Karshs "seltene Beiträge für
die Werbung". Doch nach 1945 arbeitete er für eine Anzahl Werbeagenturen;
er übernahm Aufträge von Kodak, White Owl Cigars, Brading Beer,
Calvert Distillers, RCA Victor und North Western Mutual Life Insurance.
(35) Siehe
This is Canadair, hg. Canadair, Ltd. of Montreal, General Dynamics,
New York, August 1956.
(36) Belegexemplar
einer Canadair-Annonce, Karsh Fonds, R 613, Vol. 302
(37)
Gordon Stringer, Public Relations, Canadair, an Mr. C. Drury, Stellvertr.
Verteidigungsminister, Ottawa, 22. Feb. 1955, ebenda, Vol. 302;
Zeitungsausschnitt David cox, "Karsh Teams with Canadair to Help
Fight Communism, ebenda.
(38)
Karsh Fonds, R. 613, Vol. 29.
|
|
Aus:
Yousuf Karsh - Helden aus Licht und Schatten,
Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, erschienen im G+H
Verlag, Berlin.
ISBN 3-931768-49-X
Der
Katalog ist über den Museumsladen des Deutschen Historischen
Museums zu beziehen und kann per email unter
meiske@dhm.de bestellt werden. |
|