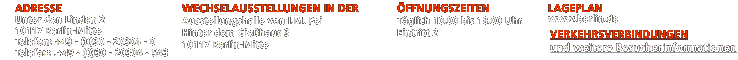Eine Ausstellung im Deutschen Historischen
Museum, Berlin
19. November 2003 bis 16. Februar 2004,
Ausstellungshalle von I. M. Pei
In Zeiten des Umbruchs und der
Krise stellt sich verstärkt die Frage nach dem
Sinn des Lebens, und die Recherche nach Identität
und Ort des Einzelnen innerhalb seiner sozialen und
kulturellen Umwelt beginnt von Neuem. Woher kommen
wir, wer sind wir? Solche elementaren Fragen überlagern
dann in der Regel die Erforschung der Seelenwelt und
Bespiegelung des Ego, die in scheinbar ruhigen Zeiten
die Oberhand haben, und rücken wiederum historische
und kulturelle Perspektiven ins Blickfeld. Kein visuelles
Medium ist geeigneter, die neuerlich auftauchenden
Fragen der sozialen Existenz anschaulicher zu beleuchten
als die Fotografie. Nicht zuletzt deswegen erfreut
sich die Fotografie gerade unter jungen Menschen,
die mit dem Fernsehen, dem Medium zerstreuter Wahrnehmung,
aufgewachsen sind, steigenden Interesses. Foto-grafische
Bilder halten zur genauen Betrachtung an und können
beständig überprüft werden. Nur wer
seine Vergangenheit kennt, hat Aussicht auf eine Zukunft.
Seltener hatte eine Aussage größere Berechtigung
als in einer diffusen Medienwelt.
Zweimal im Zwanzigsten Jahrhundert hat die deutsche
Fotografie in der Geschichte des foto-grafischen Mediums
eine herausragende Rolle gespielt: nach dem Ende des
Ersten Weltkrieges und nach der Revolte der Jugend
gegen die etablierten Mächte in Europa und den
USA während der sechziger und siebziger Jahre.
Mit den Schlagworten "Neues Sehen" und "Neue
Sachlichkeit" sowie "Kunst mit Photographie"
sind diese Impulse jeweils gekennzeichnet worden.
In beiden Fällen stand die ästhetische Frage
der Fotografie im Zentrum der Aufmerk-samkeit der
Fotografen und Künstler, und sie entdeckten die
Fotografie als legitimes künstlerisches Medium
mit einer gleichwohl eigenständigen Ästhetik.
Berlin war vor dem Nationalsozialismus das Zentrum
der fotografischen Avantgarde, Motor und Brückenkopf
zugleich. Die avancierten Künstler aus Russland
und Ungarn fanden hier vielfältige Resonanz.
Nach dem Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes
erbten mehrere Städte im westlichen Teil Deutschlands
wie Essen, Köln und Düsseldorf den "fotografischen"
Rang Berlins.
Die dritte Version eines groß angelegten Zyklus'
von Ausstellungen zum Thema "Deutsche Photographie"
widmet sich im Gegensatz zu den vorangegangenen in
Bonn und Erfurt vor-nehmlich der künstlerischen
und soziokulturellen Dimension des technischen Mediums
und berücksichtigt die komplexen Bezüge
und Korrespondenzen zur Kunst der Avantgarde sowie
den damit einhergehenden dramatischen Wandel in der
anschaulichen Darstellung des Wirk-lichen. Zugleich
erscheint die Fotografie dadurch als ein Produktionsfaktor
von Wissen über die Perspektivität einer
jeder Darstellungsform. Eine Art übergreifender
Klammer liefert die besondere Konzeption des Körpers
in der Fotografie der beleuchteten Jahre, von der
sogenann-ten "Maschinenästhetik" mit
der Etablierung der "kalten persona" in
der Weimarer Republik über die Heroisierung und
Hypostasierung des Physischen in der Nazizeit bis
zur Pluralisierung und Fragmentarisierung der Körper
in der zweiten Jahrhunderthälfte samt dem Versuch
einer neuen Körperdefinition in fotografischer
Fremd- und Selbstdarstellung. Die Folie dieser Demonstration
des körperlichen Aspekts in der Fotografie bildet
die architektonische Umwelt der Moderne.
Die Ausstellung beginnt im historischen Teil mit
den in dieser Hinsicht bedeutendsten und bekanntesten
Fotografen. August Sander, Albert Renger-Patzsch,
dem gebürtigen Ungarn László Moholy-Nagy,
Karl Blossfeldt, Werner Mantz, Raoul Hausmann sowie
Heinz Hajek-Halke. Letzterer schlägt eine Brücke
zwischen der Kultur der Weimarer und der Bonner Republik.
Zusammen mit Peter Keetman nämlich vertritt er
auch die Tendenz der "Subjektiven Fotografie".
Arno Jansen ist der bedeutendste Fotograf, der diese
Tradition bis in die Gegenwart fortsetzt und mit dem
Surrealismus verknüpft. Die wichtigsten ästhetischen
Anregungen der "Neuen Sachlichkeit" und
des "Neuen Sehens" nehmen Hilla und Bernd
Becher und Floris M. Neusüss in ihren Werken
auf. Die Schüler der Bechers wie Andreas Gursky
und Candida Höfer repräsentieren den bekanntesten
Zweig der Gegenwartsfotografie in Deutschland. Prägende
Schulen haben ebenfalls Neusüss und Jansen aufgebaut.
Wesentliche Anstöße kamen in den siebziger
Jahren von den avancierten Künstlern. Jürgen
Klauke, das Paar Bernhard Johannes und Anna Blume
sowie Katharina Sieverding erweiterten das ästhetische
Konzept der Fotografie beträchtlich. In mehr
oder minder engem Kontakt mit der Kunst der Avantgarde
schufen Künstler-Fotografen wie F. C. Gundlach,
Thomas Florschuetz, Wolfgang Tillmans, und vor allem
Gabriele und Helmut Nothhelfer eigenständige
fotografische Bildkonzepte über den Körper,
teils in enger Verbindung mit überraschenden
Entwicklungen der Modefotografie, teils in bewusstem
Gegensatz dazu.
Schon die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
lässt erkennen, dass die Ausstellung das Spektrum
der deutschen Fotografie in der Polarität der
Schwerpunkte "Körper und Architektur"
entfaltet. In prägnanten Bildern zeigt sie die
vielfältigen Beziehungen zwischen den Menschen
und ihrer Umgebung während der vergangenen hundert
Jahre und vergegenwärtigt Architektur in diesem
Zusammenhang als ein ambivalentes Element. Einerseits
objektivieren sich in den Zeugnissen der modernen
Architektur Baukörper mit eigenem Recht, die
bisweilen eine menschenfeindliche Ausstrahlung besitzen
können, andererseits erscheint Architektur in
ihrer Funktion als Schutz, als Erweiterung der Haut,
der Kleidung, als Hülle der Menschen. Ebenso
manifestiert sich in den fotografischen Bildern der
neu-sachlichen Fotografie die Verselbstän-digung
der Dingwelt, der natürlichen wie der handwerklich
oder industriell gefertigten, so dass sich für
die menschliche Körperwelt aus diesem Umstand
neuerliche Herausforderungen ergeben.
Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der zeitgenössischen
Fotografie. Sie demonstriert die Bandbreite fotografischer
Möglichkeiten von einer primär aus der Sicht
des Malerischen geprägten Haltung mit einem noch
körperlichen (handwerklichen) Einsatz (Anke Erlenhoff)
bis zur "neuen Künstlichkeit" durch
Verwendung digitaler Technik (Andreas Gursky), von
der forcierten Inszenierung der Körper (Olaf
Martens) bis zur "lapidaren Beiläufigkeit"
in der Darstellung (Daniel Josefsohn).
Ein durchgängiges Subthema der Ausstellung ist
die Zeit. Die Zeitlichkeit der Körper ist Gegenstand
der Tableauxs von Dieter Appelt ebenso wie der "Timescapes"
von Michael Ruetz und klingt unter der Hand auch in
zahlreichen anderen Beiträgen immer wieder auf.
Die zeitlich bedingte Auffassung vom Körper tritt
in scharfen Kontrast zu der heroischen, gleichsam
zeitlosen in den Bildern von Fotografen der dreißiger
Jahre wie Herbert List, Leni Riefenstahl und Max Ehlert.
Während List und Riefenstahl dem individuellen
Körper klassischer Observanz huldigen, feiert
Ehlert den menschlichen Körper als Element der
wehrhaften Kolonne, Ornamente der Masse, die wenig
später die Nachbarstaaten überrollen wird.
Obendrein entwirft "Von Körpern und anderen
Dingen - Deutsche Fotografie im 20. Jahrhundert"
ein Spiegelbild sämtlicher Spielarten moderner
Autorenfotografie.