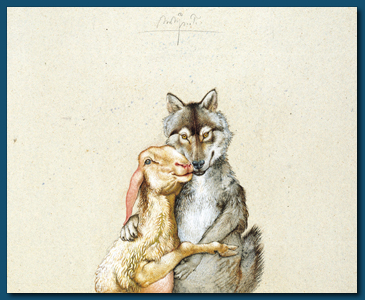 |
Wie
sie da stehen! Selbstbewusst und unaufdringlich. In liebevoller
Umarmung aneinander gekuschelt, zärtlich vereint, Schnauze
an Schnauze. Einfach süß!
Und
doch ein so unmögliches Paar. An diesem herzallerliebsten
Anblick kann sich der moderne Mensch etwas aufrichten, der
niedergedrückt ist von Selbstzerrissenheit und Widersprüchen,
Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie vom endlosen Fluss
der Nachrichten über Neid, Selbstsucht, Hass, Mord, Totschlag
und vieles andere wenig Erbauliche mehr. Dieses tierische
Paar macht das alles vergessen. Dass in der Geschichte der
eine dem anderen immer ein Wolf war und heute noch ist.
Es ist ein leuchtendes Beispiel für die Macht der Liebe,
die das Animalische bezwingt und die rohen Instinkte in
etwas Höheres, Fortentwickeltes, Fortschrittliches, in Kultur
sublimiert. Die Grenzen der Natur werden überwunden durch
ihre Steigerung ins Erhabene.
|
So
stellt uns das Utopische Paar den gelungenen Zivilisationsprozess,
den paradiesischen Zustand vor, in dem die Ungleichen gleich und
die Andersartigen Brüder und Schwestern sind. Dieses rundum glückliche
und zufriedene Paar ist das Beispiel für die ideale conditio humana:
Niemand ist mehr bloßes Mittel, sondern Zweck des anderen. Der
die Welt beherrschende Teufelskreis ist durchbrochen, die Evolution
endlich an ihr Ende gekommen. Fressen muss Mann und Maus nicht
mehr, und gefressen wird auch nicht mehr. Allüberall Harmonie
und Idealität. Botschafter dieser Zukunftsvision sind die beiden.
Schaf und Wolf. Bis in graue Vorzeit im Streit entzweit, waren
sie die Stellvertreter eines unmöglichen Verhältnisses. Fabeln,
Parabeln und Gleichnisse der vergangenen 1000 Jahre legen Zeugnis
davon ab.
Bei
Prechtl ist alles anders. Hier haben sie endlich zueinander gefunden,
sind sogar unzertrennlich geworden. Sein Utopisches Paar ist die
visuelle Parabel des Glücks des Unmöglichen. "Das utopische Prinzip
wird erst wahr, wenn sich Wolf und Schaf in Liebe umarmen", sagte
Prechtl.
Das
Utopische Paar zierte als farbiger Schutzumschlag das 1986 von
der Frankfurter Büchergilde Gutenberg herausgegebene Buch Utopia
von Sir Thomas More, auf deutsch Morus genannt. Die von Prechtl
mit 16 "zeitnahen Bildern" illustrierte Ausgabe des Buchs hatte
bis 1991 vier Auflagen. Das Utopische Paar wurde zu dem populärsten
und am häufigsten reproduzierten Motiv der Prechtlschen Bildwelt.
Die Nürnberger Zeitung druckte es zur Jahreswende 1999/2000 gleich
in Groß auf der Titelseite ihrer Sonderbeilage ab, unter der Überschrift
"Krieg, Zerstörung und Hoffnung". Wie kein anderes war das 20.
Jahrhundert beherrscht von Kriegen, Genozid, Vertreibung und Flüchtlingsströmen.
Sie machen das vergangene Jahrhundert zum blutigsten und opferreichsten,
seit der Mensch Geschichte aufzeichnet. Das Diktum vom Menschen
als "Wolf" des Menschen bewies aufs neue seine Wahrheit, auch
wenn der von Generation zu Generation überlieferte Spruch in einem
Punkt nie stimmte: Wölfe rotten nicht ihre eigenen Artgenossen
aus, das tut nur die Gattung Mensch. Richtig müsste es daher heißen,
der Mensch ist dem Menschen ein Mensch. Die Aussage schließt all
die Schrecken und das unvorstellbare Leid, die Menschen anderen
Menschen bereiteten, ein.
Die
Nürnberger Zeitung bildete das Utopische Paar als ironisches,
nichtsdestotrotz ernst gemeintes Symbol der Hoffnung auf bessere
Zeiten ab. Diese Sinnschicht erklärt möglicherweise die Beliebtheit
des Motivs. Zwar ist der dargestellte Zustand wider die Natur
und daher völlig unmöglich, insoweit folgt Prechtl einer pessimistischen
Philosophie. Das kann der Mensch niemals erreichen, selbst wenn
er es wollte. Doch das anthropomorphistische Wunschbild visualisiert
mit seinem ganz und gar utopischen Verhältnis die denkbare Möglichkeit
einer anders verfassten Welt. Die Freude, die das Bild macht,
resultiert vielleicht aus der Erkenntnis, dass der Mensch die
Fähigkeit hat, Gegebenes zu erkennen, es zu durchdringen, mit
Wissen und Handeln zu übersteigen. Selbst wenn er das Unmögliche
nicht möglich machen kann, erlebt er seine Phantasie als einen
Augenblick des Glücks.
|

