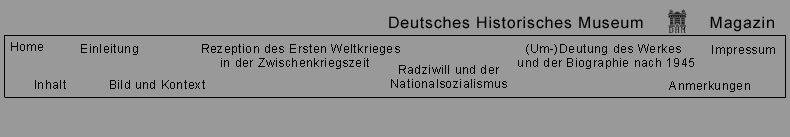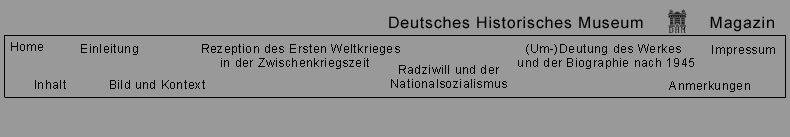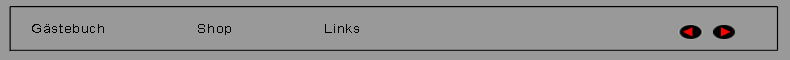Anmerkungen
1 Kriegszeit, Nr. 39, 12. Mai 1915.
2 Ernst Jünger, Wäldchen 125. Der Krieg als inneres Erlebnis, Bielefeld und Leipzig o. J., S. 39.
3 Zitiert nach Gerhard Wietek, Franz Radziwill - Wilhelm Niemeyer. Dokumente einer Freundschaft, Oldenburg 1990, S. 259.
4 Roland März, Franz Radziwill - ein visionärer Realist. Ahnung und Gegenwart in der Weimarer Republik von 1923 bis 1933, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill. "Das größte Wunder ist die Wirklichkeit", Emden 1995, S. 24.
5 Diese Einschätzung äußerte Van Dyke in einem Vortrag anläßlich einer Ausstellungseröffnung mit Werken von Radziwill in der Berliner Galerie Zunge am 8. September 1998.
6 Hans Heinrich Maaß-Radziwill, Franz Radziwill im "Dritten Reich". Der andere Widerstand, Bremen 1995; James A. Van Dyke, Franz Radziwill. The Art Politics of National Socialist Regime, and the Question of Resistance in Germany
1930-1939, Chicago 1996 (Phil. Diss. Northwestern Univer-
sity, unveröffentlicht); ders., Von "Revolution" zu "Dämonen" - Franz Radziwill im Dritten Reich, in: Ausst.-Kat. Das Konzentrationslager "Oranienburg", Günter Morsch (Hg.), Bremen 1994, S. 40-46; ders., Franz Radziwill. ›Die Gemeinschaft‹ und die nationalsozialistische ›Revolution‹ in der Kunst, in: Georges-Bloch-Jahrbuch, 1997, Bd. 4, S. 135-163; Karin Adelsbach / James A. Van Dyke / Claus Peukert, Biographie Franz Radziwills, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 47-65. Jüngst ist von Olaf Peters eine Dissertation zu Radziwill unter dem Titel "Tradition und Kritik", Universität Bochum 1997, vorgelegt worden, die unter dem Titel "Neue Sachlichkeit und Nationalsozialismus. Affirmation und Kritik 1931-1947, Berlin 1998, erschienen ist. In ihr wird ausführlich auf Radziwills Haltung im "Dritten Reich" und das in dieser Zeit entstandene Werk eingegangen. Im Emdener Katalog beschäftigt sich auch Roland März in seinem Aufsatz "Franz Radziwill - ein visionärer Realist, Ahnung und Gegenwart in der Weimarer Republik von 1923 bis 1933", S. 17-29, mit Radziwills Vergangenheit im "Dritten Reich". Von besonderer Bedeutung als Quellensammlung ist Gerhard Wietek (wie Anm. 3). Hans Heinrich Maaß-Radziwill plant für 1999 die Veröffentlichung seines 2. Bandes über "Franz Radziwill. Der andere Widerstand" im Bremer Hauschild Verlag. Allerdings legt die Dissertation von Olaf Peters in überzeugender Weise und faktenreich dar, daß der Künstler bereits vor 1933 und noch Jahre danach eindeutig für den Nationalsozialismus Stellung bezog.
7 Vgl. Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 283.
8 Olaf Peters (wie Anm. 6) behandelt in Kapitel 3, Abschnitt III., unter der Überschrift "Brutalisierung der Politik: Franz Radziwill und die ›deutsche Revolution‹", S. 144-164, eingehend die Thematik. Auch James A. Van Dyke hat sich dieser Frage in seinen letzten Arbeiten ausführlich gewidmet.
9 Brief an Wilhelm Niemeyer, Mitte Oktober 1923, in: Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 65.
10 Vgl. Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 153, Fußnote 522.
11 Max Rabes, Am Grabenspiegel, 1916, Öl auf Leinwand,
65 x 46 cm, Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt.
12 Olaf Peters' Ausführungen diesbezüglich (wie Anm. 6) bleiben trotz ihres Materialreichtums insgesamt unbefriedigend, da seine Untersuchung des Bildes keine detaillierte Analyse der Symbolik und Ideologie beinhaltet.
13 Grab im Niemandsland, Öl auf Leinwand auf Holz,
133 x 92 cm, Deutsches Historisches Museum; Der Unterstand am Naroczsee, Öl auf Leinwand auf Holz, 99 x 140 cm,
Privatbesitz, Hamburg; Das Schlachtfeld von Cambrai, 1917, Öl auf Leinwand auf Holz, 99 x 140 cm, Standort unbekannt.
14 Zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 240.
15 Diese Annahme äußert Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 219, Fußnote 953.
16 Siehe Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 173; Peters geht auf die Frage, ob Dix' Triptychon
als Vorbild diente, ein. Vgl. S. 175.
17 Auch "Stahlhelm im Niemandsland" genannt; Öl auf Leinwand auf Holz, 64 x 53 cm,
Stadtmuseum Oldenburg. 1934 wurde das Bild "Der Stahlhelm" als Schutzumschlag für Georg
von der Vrings Kriegsroman "Der Goldhelm oder das Vermächtnis von Grandcœur" verwendet
und hatte dort den Titel "Der Helm des gefallenen Freundes"; Hans Heinrich Maaß-Radziwill
(wie Anm. 6), S. 39.
18 In einer Rezension von C. O. Jatho zu einer Radziwill-Ausstellung Ende 1937 im Kölner
Kunstverein trägt das Bild noch den Titel "Der Stahlhelm des Gefallenen", in: Hans Heinrich
Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 17.
19 Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 154.
20 Wilhelm Niemeyer, Franz Radziwill - Der Sechzigjährige, 1955, zitiert nach
Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 257.
21 Siehe Werner Busch, Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung
in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts, Berlin 1985, S. 298 ff.: "Und zwar indem er,
ganz im Hegelschen Sinne, den absoluten Weltgeist, den Geist der Natur, mit dem
Menschengeist, dem Geist der Geschichte, gleichsetzt und jenen durch diesen ersetzt.
Die frühere sogenannte historische Landschaft wollte die Natur an sich … darstellen,
Rottmann möchte den Geist der Geschichte der dargestellten Örtlichkeit in seinen
Landschaften lebendig werden lassen und kristallisieren."
22 Zitiert nach Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 54.
23 Zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 240.
24 Zitiert bei Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 33.
25 James A. Van Dyke, Franz Radziwill. ›Die Gemeinschaft‹ und die
nationalsozialistische ›Revolution‹ in der Kunst (wie
Anm. 6), S. 143.
26 Das Buch wurde gleich nach seinem Erscheinen verboten, vier Jahre später aber
wiederaufgelegt. Hans Heinrich Maaß-Radziwill folgert daraus, daß auch Radziwill eine
kritische Position gegenüber dem Krieg bezogen haben müsse, da er sein Bild dem den
Nationalsozialisten unliebsamen Autor zur Verfügung stellte. Es ist aber keineswegs
zwingend, aus diesem Umstand zu folgern, daß das Bild mit einer kriegskritischen
Intention gemalt wurde und daß das zensierte Buch zugleich Radziwills Nazi-Gegnerschaft
illustriert. Hier gilt auch zu bedenken, daß das Buch wegen seines Inhalts auf den Index
gelangte und nicht wegen des Schutzumschlags, gegen den die Nationalsozialisten
offensichtlich kaum etwas einwenden konnten, wenn wir den Erfolg von Henrichs "1917" in
die Überlegungen mit einbeziehen; siehe Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 39.
27 Ursprünglich war für das Bild der Titel "Denkmal Radziwill" vorgesehen - unter
diesem ist es im Werkverzeichnis des Künstlers eingetragen worden. Möglicherweise wollte
der Maler mit dem Bild eines seiner Brüder gedenken, der im Oktober 1916 gefallen war.
Jedoch erhielt das Gemälde dann den Titel "Der Stahlhelm des Gefallenen". Unter diesem
Titel wird es in der Rezension "Der Maler Franz Radziwill / Zu einer Ausstellung im
Kölner Kunstverein" von
C. O. Jatho in einer Bremer Zeitung im Jahr 1937 genannt.
28 Brief Wilhelm Niemeyers an Radziwill vom 31. März 1937, in: Gerhard Wietek
(wie Anm. 3), S. 153.
29 Öl auf Leinwand, Maße und Standort unbekannt. Abgebildet war das Bild in der
von Alfred Rosenberg herausgegebenen repräsentativen Zeitschrift "Kunst im Dritten Reich",
3. Jg., Folge 7 / Juli 1939, S. 357.
30 Diese Vorstellung ist älter, fand aber am Ende des 19. Jahrhunderts eine
Popularisierung durch die Philosophie Nietzsches. Hans Heinrich Maaß-Radziwill weist
darauf hin, daß Radziwill Nietzsche gelesen hat (wie Anm. 6).
31 1933 trat Dettmann in die NSDAP, 1934 in die SA ein, wo er 1938 den Rang eines
Truppführers erhielt. Darüber hinaus war er Träger des Blutordens und Mitglied in
der NS-Volkswohlfahrt.
32 Vgl. Hans-Christian Kirsch, Worpswede. Die Geschichte einer Künstlerkolonie,
München 1987.
33 Mackensen zitiert nach Hans-Christian Kirsch (wie Anm. 32), S. 208/209.
34 Mensch und Werk. Der Maler Franz Radziwill, vorgestellt
von Hans-Jürgen Paape, Feature Radio Bremen, Sendung am 19. Mai 1979,
Typoskript im Staatsarchiv Bremen, S. 4.
35 Ebd., S. 5.
36 Rainer W. Schulze, Interview mit Franz Radziwill, September 1971,
in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 67.
37 Mensch und Werk (wie Anm. 34), S. 5.
38 Rainer W. Schulze (wie Anm. 36), S. 67.
39 Wulf Schomer, Das Frühwerk Franz Radziwills - Anmerkungen, in: Kunst im Ostseeraum,
hg. von Brigitte Hartel / Bernfried Lichtnau, Bd. 1, 1995, S. 87.
40 Ebd.
41 Die Tankschlacht und die Angriffsschlacht bei Cambrai, Verfasst von
Offizierkriegsberichterstattern der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht, Herausgegeben von
der Feldpressestelle im Hauptquartier Mézières-Charlesville, 1918, S. 5/6.
42 Die Tankschlacht bei Cambrai, 20.-29.11.1917, Hauptmann a. D. Georg Strutz,
Verfasser: Hauptmann a. D. Georg Strutz, Archivrat beim Reichsarchiv,
Oldenburg i. O. / Berlin 1929.
43 Ehrenmal der Deutschen Armee und Marine (Volksausgabe, Ort unbekannt), um 1930.
44 Christian Zentner, Illustrierte Geschichte des Ersten Weltkrieges, München 1980, S. 249.
45 George L. Mosse, Gefallen für das Vaterland, Stuttgart 1993, S. 223.
46 Aus: Mein Vaterland, Lesebuch für die Heeres- und Marinefachschulen.
Im Auftrage des Reichswehrministeriums neu herausgegeben von Ministerialrat
Dr. B. Beyer, Berlin 1930,
S. 399-400.
47 Sabine Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen,
Riten und Symbole, Vierow bei Greifswald 1996, S. 157.
48 Adolf Hitler, Mein Kampf, München 1933, S. 182.
49 Zu der Fortschreibung dieser Ikone bis in die dreißiger Jahre siehe Detlef Hoffmann,
Der Mann mit dem Stahlhelm vor Verdun. Fritz Erlers Plakat zur sechsten Kriegsanleihe 1917,
in: Hinz/Mittig/Schäche/Schönberger (Hg.), Die Dekoration der Gewalt. Kunst und Medien im
Faschismus, Gießen 1979,
S. 101-114.
50 Fritz Erler zitiert nach Fritz von Ostini, Fritz Erler, Bielefeld und Leipzig 1921,
S. 134.
51 Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen
Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München 1937 (Erstauflage 1930), hier zitiert nach Werner
Ritter, in: Kunst im Dritten Reich (wie Anm. 29).
52 Ludwig Hohlwein, Wahr dich. Wehr dich. Wach auf. Melde dich zur bayr. Reichswehr,
1919, 73 x 95 cm, Stadtmuseum München. Siehe hierzu Detlef Hoffmann (wie Anm. 49).
53 Heide Platen, Das Rattenbuch. Über die Allgegenwart eines verleugneten Nachbarn,
Frankfurt am Main / New York 1997, S. 194.
54 Der Krieg (Triptychon mit Predella), Mischtechnik auf Holz, Mittelteil 204 x 204 cm,
Flügel 204 x 102 cm, Predella
60 x 204 cm, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Flandern, Mischtechnik auf Leinwand,
200 x 250 cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin.
55 Otto Dix zitiert nach Dietrich Schubert, Otto Dix in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1980, S. 100.
56 Diether Schmidt, Otto Dix im Selbstbildnis, Berlin 1981,
S. 123.
57 Lothar Fischer, Otto Dix, ein Malerleben in Deutschland, Berlin 1981, S. 17.
58 Vgl. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, Frankfurt am Main /
Berlin 1976, S. 46.
59 Dix im "Gespräch im Wartezimmer", 1958, zitiert nach Diether Schmidt
(wie Anm. 56), S. 228.
60 Dix im Gespräch mit Karl-Heinz Hagen, Dezember 1964, zitiert nach Diether
Schmidt (wie Anm. 56), S. 262.
61 Ebd.
62 Gespräch mit Fritz Löffler, August 1957, zitiert nach Diether Schmidt (wie Anm. 56), S. 225.
63 Ebd., S. 224.
64 Krieg, Holzschnitt, 30 x 21 cm, Neudruck aus der Mappe: Gerd Arntz, Lehrbilder
1931-38, hg. von Werner Kunze, Köln 1976, Galerie Glöckner.
65 Dietrich Schubert (wie Anm. 55), S. 115.
66 Hildebrand Gurlitt (1895-1956), bis 1930 Leiter des Museums in Zwickau, das er
wegen seines Einsatzes für die moderne Kunst verlassen mußte; ab 1933 in Hamburg.
67 Werner Kloos (1909-1990) war ab 1936 Assistent an der Hamburger Kunsthalle, 1938
Kustos, 1941 Direktor. Siehe zur Geschichte der Hamburger Kunsthalle im "Dritten Reich"
und zur NS-Vergangenheit von Kloos: H. W. Schmidt, Die Hamburger Kunsthalle 1933-1945.
Chronologie des Verwaltens und Verwandelns einer Sammlung, in: Verfolgt und verführt.
Kunst unterm Hakenkreuz, Marburg 1983.
68 Brief Radziwills an Wilhelm Niemeyer, zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 153.
69 Brief Niemeyers an Radziwill am 31. März 1937, zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3),
S. 153.
70 Öl auf Leinwand, ca. 180 x 220 cm, Standort unbekannt.
71 Maße und Standort unbekannt. Abgebildet in: Kunst im Deutschen Reich, Sonderheft
"Große Deutsche Kunstausstellung", Juli/August 1940, S. 38.
72 Brief Radziwills an seine Frau Johanna-Ingeborg Radziwill vom 10. Juni 1938,
zitiert nach Karin Adelsbach / James A. Van Dyke / Claus Peukert, Biographie Franz
Radziwills, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 58.
73 James A. Van Dyke, in: Konzentrationslager "Oranienburg" (wie Anm. 6), S. 43.
74 Öl auf Leinwand auf Holz, 123 x 170 cm, Privatbesitz, Bremen (als Dauerleihgabe
in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München).
75 Erich Ludendorff, Der totale Krieg, München 1935, S. 5.
76 Ebd.
77 Mensch und Werk (wie Anm. 34), S. 25/26.
78 Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Oldenburg 1992, S. 612.
79 Vgl. Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 149.
80 Laut mündlicher Aussage von Claus Peukert, dem Leiter
des Radziwill Hauses und Archivs in Dangast, war Düser
aller Wahrscheinlichkeit nach Mitglied der NSDAP und Radziwills "Busenfreund".
Die Nachfahren des in Oldenburg praktizierenden Arztes, zwei Söhne, die Radziwill noch
selbst kennengelernt hatten, reden ungern über diese Vergangenheit. In dem Dokumentarfilm
"Konsequent - Inkonsequent. Der Maler Franz Radziwill" (Deutschland, 1995) räumen die
Regisseurinnen, Konstanze Radziwill und G. Rohde-Dahl, den Interviews mit den beiden
Söhnen breiten Raum ein.
81 Zum Beispiel im Ausst.-Kat. Zwischen Krieg und Frieden. Gegenständliche und
realistische Tendenzen in der Kunst nach 45, hg. vom Frankfurter Kunstverein,
Berlin-West 1980, S. 202. Zuletzt findet sich diese Behauptung im Beitrag von Brigitte
Reinhardt, "Das größte Wunder ist die Wirklichkeit". Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg
von 1945 bis 1972, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 38, und im Dictionary
of Art, hg. von Jane Turner, London / New York 1996, Bd. 25, S. 842. Radziwill erklärte
selbst in seinem Wiedergutmachungsverfahren am 24. Juni 1954: "Ja, man erwägte sogar mich
aus der Partei auszustossen, da ich mit verschiedenen Bildern in der Ausstellung
›Entartete Kunst‹ gezeigt wurde und ein Parteigenosse verlangte, daß Parteigenossen,
die auf der Ausstellung ›Entartete Kunst‹ (vertreten waren), von der Partei
auszuschliessen seien. Dieser Ausschluß ist aus unerklärlichen Gründen nicht
vollzogen worden und ich selbst hatte keinen Anlass, wie ich vorher schon gesagt
hatte, dieses von mir aus zu tun." Von Radziwill unterzeichnetes Blatt im Franz
Radziwill Haus und Archiv, Dangast; hier zitiert nach Olaf Peters (wie Anm. 6),
S. 152, Fußnote 517.
82 Radziwill zitiert nach Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 153.
83 Jürgen Weichardt, Franz Radziwill, in: Biographisches Handbuch (wie Anm. 78), S. 575-578.
84 "Wie malt Professor Radziwill?", in: Wilhelmshavener Kurier, 6. April 1938. Als
"Landsmann" wurde Radziwill deshalb gewürdigt, weil er bei den Angriffen auf seine
Person wegen seines "russisch" klingenden Namens verdächtigt wurde, gebürtiger Russe
und damit "undeutsch" zu sein.
85 Bernd Küster, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill, Oldenburg 1981, S. 15; hier zitiert
nach Olaf Peters (wie Anm. 6),
S. 147.
86 Lexikon der Kunst, Bd. 6, Leipzig 1994, S. 11.
87 Peter Ulrich Hein, Die Brücke ins Geisterreich. Künstlerische Avantgarde zwischen
Kulturkritik und Faschismus, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 251.
88 Ulrich Gerster, Zwischen Avantgarde und Rückwendung. Die Malerei Franz Radziwills
von 1933 bis 1945, in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 3), S. 31.
89 Gotthard Vierhuff, Die Neue Sachlichkeit. Malerei und Fotografie, Köln 1980, S. 32.
90 Ebd.
91 Ich stütze mich hier auf die Durchsicht der Ausschnittsammlung von Zeitungsartikeln über
Franz Radziwill im Staatsarchiv Bremen und den Ausst.-Kat. Franz Radziwill, Bremer
Kunsthalle, (Hg.) Günter Busch, Bremen 1970.
92 Brief Niemeyers an Radziwill, zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 139.
93 Vgl. Gerhard Wietek (wie Anm. 3).
94 Brief Radziwills an Niemeyer, zitiert nach Gerhard Wietek (wie Anm. 3), S. 143.
95 Vgl. hierzu die Ausführungen von Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 149 f.
96 Brief Martins an Radziwill vom 15. Dezember 1932, zitiert nach Hans Heinrich
Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 47/48.
97 Brief Martins an Radziwill vom 26. Dezember 1932, zitiert nach Hans Heinrich
Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 48. Hans Heinrich Maaß-Radziwill kommt vor dem
Hintergrund dieser Dokumente zu dem Ergebnis: "Diese Form des Widerstands gegen
die ideologischen Grundlagen und gegen den totalitären Herrschaftsanspruch des
NS-Regimes (ist) mindestens gleichrangig neben klassische, gewaltsame Formen des
Widerstandes zu stellen, ja, letztlich entscheidender und geschichtsmächtiger." Die
Dokumente ließen "nur den Schluß zu, daß sich Martin und Radziwill schon 1932 in
einer überraschend hellsichtigen Beurteilung der mit der bevorstehenden Machtergreifung
der NSDAP drohenden Gefahren zum Handeln entschließen, d. h. zur hartnäckigen Einwirkung
auf das damals noch einflußreiche preußische bzw. Reichs-Kultusministerium, das
durchsetzungsfähig auch gegenüber Parteiorganisationen der NSDAP und nazistischen
Kulturkampfbünden erscheint" (S. 46).
98 Vgl. James A. Van Dyke, Von "Revolution" zu "Dämonen" (wie Anm. 6), S. 43: "Seit
spätestens 1932 hatten Radziwill und seine Freunde wie Martin sich zur NSDAP bekannt,
während die als machtpolitisch schwache künstlerische Elite und sich selbst überschätzende
Gralshüter der nationalen ›Idee‹ sowohl die populistische Kunstpolitik der
Parteiorganisationen als auch einzelne völkische Querulanten und Intriganten
ablehnten." Hierzu auch ders., Franz Radziwill. ›Die Gemeinschaft‹ und die
nationalsozialistische ›Revolution‹ in der Kunst (wie Anm. 6), und die
detaillierten Ausführungen von Olaf Peters im Kapitel "Franz Radziwill und die Frage
der Opposition 1932/33 und 1944" (wie Anm. 6),
S. 262-288.
99 Brief Radziwills an seine Frau Johanna-Ingeborg Radziwill, Berlin - undatiert,
vermutlich Ende Februar 1933, zitiert nach Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 65.
100 Brief Radziwills an seine Frau Johanna-Ingeborg Radziwill, Berlin, 1. März 1933,
zitiert nach Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 66.
101 Brief Radziwills an seine Frau Johanna-Ingeborg Radziwill, Berlin, 7. März 1933,
zitiert nach Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 67.
102 Brief Radziwills an seine Frau Johanna-Ingeborg Radziwill, Berlin 20. März 1933,
zitiert nach Hans Heinrich Maaß-Radziwill (wie Anm. 6), S. 67.
103 Karin Adelsbach / James A. Van Dyke / Claus Peukert, Biographie Franz Radziwills,
in: Ausst.-Kat. Franz Radziwill (wie Anm. 4), S. 55.
104 Hans Heinrich Maaß-Radziwill wertet auch dies als Ausdruck "geistigen Widerstands",
da der gelernte Maurer aus Bremen gerade dieses Datum gewählt hätte, um seine
Solidarität mit der Arbeiterklasse und den Gewerkschaften zu bekunden.
105 Hellmut Kotschenreuther, Zwischenraum der Wirklichkeit. Franz Radziwill in der
Kunsthalle Berlin, in: Stuttgarter Zeitung, 7. Dezember 1981.
106 Zitiert nach James A. Van Dyke, Von "Revolution" zu "Dämonen" (wie Anm. 6), S. 43.
107 Wie Anm. 84.
108 Brief Radziwills an Niemeyer, 12. Oktober 1937, zitiert nach Gerhard Wietek
(wie Anm. 3), S. 154.
109 Mensch und Werk (wie Anm. 34).
110 Wilhelm Niemeyer (wie Anm. 3), S. 259.
111 Zu diesem wichtigen Thema siehe Iko Chmielewski, Franz Radziwill.
Übermalungen in seinen Werken, Oldenburg 1989 (unveröffentlichte Magisterarbeit;
Typoskript im Radziwill-Haus Dangast).
112 Siehe hierzu die Arbeiten von James A. Van Dyke (wie Anm. 6) und das Kapitel
"Brutalisierung der Politik: Franz Radziwill und die ›deutsche Revolution‹",
in: Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 144-164. Peters zeigt die Veränderungen im Detail auf.
113 Öl auf Leinwand, 95 x 105 cm, Deutsches Historisches Museum.
114 Zu dieser Einschätzung gelangte Claus Peukert, der den im Dangaster
Radziwill-Archiv aufbewahrten Schriftverkehr zur "Wiedergutmachung" anläßlich der
Emdener Ausstellung von 1995 untersuchte.
115 Vgl. die maschinenschriftliche Liste "Erläuterung zu den Bildern" vom 3. Dezember 1955,
Radziwill Haus und Archiv, Dangast; hier zitiert nach Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 164.
116 Zum "Fall" Mackensen siehe meinen Aufsatz in dem Buch "Worpswede im ›Dritten Reich‹",
hg. von Arn Strohmeyer / Kai Artinger u. a., voraussichtliches Erscheinungsdatum 1999.
117 Rainer W. Schulze (wie Anm. 36), S. 71/72.
118 George Grosz war 1919 Mitglied der KPD geworden, 1923 aber wieder ausgetreten.
119 Vgl. Ralph Jentsch, George Grosz. Chronik zu Leben und Werk, in: Ausst.-Kat.
George Grosz. Berlin - New York, hg. von Peter-Klaus Schuster, Berlin 1994, S. 547.
120 Olaf Peters (wie Anm. 6), S. 288.
|