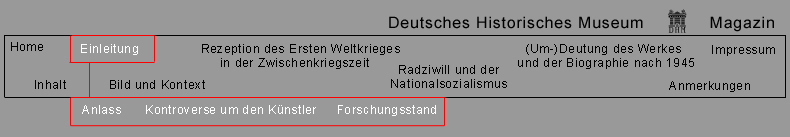
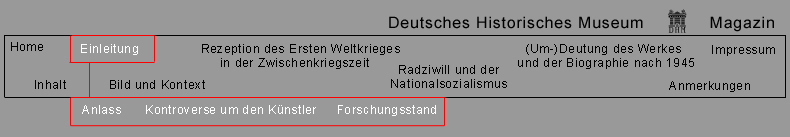
|
Kontroverse um den KünstlerFranz Radziwill, in Stroheim bei Rodenkirchen in Oldenburg als ältestes Kind eines Töpfermeisters geboren und in Bremen aufgewachsen, wird heute nicht nur im niedersächsischen Raum zu den bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts gezählt, sondern gehört auch zu den bekanntesten Vertretern der Neuen Sachlichkeit in Deutschland. Ausgehend von der expressionistischen Malerei, die stark beeinflußt war von Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Max Pechstein und anderen, entwickelte der künstlerische Autodidakt ab Mitte der zwanziger Jahre in der Auseinandersetzung mit den großen Niederländern des 17. Jahrhunderts und der deutschen romantischen Malerei eine ganz eigenständige, scheinbar objektive und gegenständliche Bildwelt, die Mensch, Technik und Natur in düster-surrealen Situationen miteinander konfrontiert. Die Behandlung der Gegenstände zeichnet sich durch fast photographische Detailschärfe und eine leuchtende, oft irreal wirkende Farbigkeit aus. Hat Radziwills Kunst heute einen festen Platz in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, so ist die Persönlichkeit des Künstlers infolge seiner Zugehörigkeit zur NSDAP und seines Engagements für den Nationalsozialismus doch umstritten geblieben. Anläßlich der Emdener Retrospektive gab es eine Kontroverse über seine Haltung im "Dritten Reich". Kontrahenten der Diskussion waren insbesondere der amerikanische Kunsthistoriker James A. Van Dyke und der Schwiegersohn Radziwills, der Bremer Jurist Hans Heinrich Maaß-Radziwill. Während Van Dyke und andere Kunsthistoriker von der aktiven Beteiligung des Künstlers am Nationalsozialismus ausgehen und davon überzeugt sind, daß er zumindest in der Zeit von 1930 bis 1934 ein "glühender Anhänger"5 war, plädiert Maaß-Radziwill für eine differenziertere Einschätzung von Radziwills Haltung. Er kommt zu dem entgegengesetzten Ergebnis, der Maler wäre trotz seines Eintritts in die NSDAP am 1. Mai 1933 in Wirklichkeit ein "Dissident", ein "anderer Widerstandskämpfer" gewesen. Maaß-Radziwill rechnet ihn deshalb zu den Vertretern des sogenannten anderen Deutschlands. Die wissenschaftlichen Untersuchungen der jüngsten Zeit und die erhaltenen Quellen zeigen aber, daß Maaß-Radziwills Einschätzung nicht haltbar ist.6 Vor dem Hintergrund dieses bis heute nicht endgültig beigelegten Streits kommt der Erwerbung des Deutschen Historischen Museums ein besonderes Interesse zu, da sie Radziwills ideologische Haltung zu Beginn des "Dritten Reiches" veranschaulicht und sein Engagement für den Nationalsozialismus nachvollziehbar macht. Die These dieser Untersuchung ist, daß Radziwill das Kriegsbild keineswegs zufällig malte, sondern mit der wohlkalkulierten Absicht, seine Kunst zu diesem Zeitpunkt auf die ideologische Linie der neuen Machthaber zu bringen. Sein Eintreten für das NS-Regime ist damit weniger unerklärlich, als das einige Kunsthistoriker immer noch glauben machen wollen. Einer heute verbreiteten Annahme nach kann ein als "entartet" klassifizierter, von den Nationalsozialisten "verfolgter" Künstler kein überzeugter Anhänger des NS-Regimes gewesen sein. Im Falle Radziwills, der 1937 als "entartet" geächtet wurde, muß davon ausgegangen werden, daß er Nationalsozialist zumindest bis Ende 1944 blieb. Die Quellen legen nahe, daß er sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht vom Regime distanzierte.7 Im folgenden soll auf die Fragen eine Antwort gesucht werden, warum der Künstler gerade im Jahr 1934 das Weltkriegsgedächtnisbild "Grab im Niemandsland" schuf und ob und inwieweit die darin zum Ausdruck kommenden Überzeugungen sich mit der Ideologie des Nationalsozialismus deckten. Zu klären ist das Problem, ob es sich bei dem Gemälde um eine sublime Heroifizierung des Soldatenopfers und eine Mythologisierung des Krieges handelt, die beide feste Bestandteile des nationalsozialistischen Gefallenenkultes waren. |
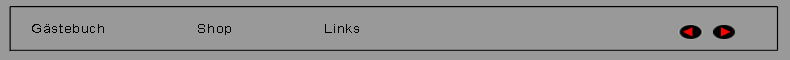 |