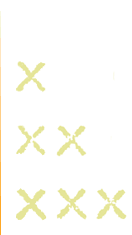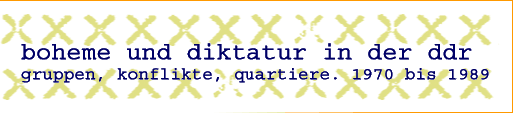
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
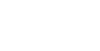 |
||
So kam man untereinander schnell und unkompliziert in Kontakt – die in der DDR übliche Duz-Kultur, ohnehin nicht vom Kammerton halbdistanzierter Konversation geprägt, tat ein Übriges. Der Alkoholkonsum war enorm, die billigen Osteuropa-Rotweine à la “Gamza”, “Stierblut” oder “Cabernet” wurden zum Hauptrauschmittel einer Gesellschaft, in der Drogen nur ganz selten ins Land kamen und im Prinzip keine Bedeutung erlangten. Selbstangebauter Hasch-Ersatz aus Stieglitzfutter blieb eine exotische Attitüde. Dafür entschädigte man sich mit einer hohen Promiskuitätsrate, die auch nach der weltweiten Aids-Warnung eher zur Normalität in den Boheme-Gruppen gehörte. “Es waren die ewigen Jagdgründe”(29), erinnert sich etwa der Dichter, Performer und Filmer Thomas Roesler. Olaf Tost, Mitbegründer der Rockband die anderen bestätigt die Kontinutität dieses Phänomens bis in die späten 80er Jahre: “Die Bereitschaft zu spontanem und zu nichts verpflichtendem Sex war groß. Die Angst vor Aids spielte eine geringe Rolle.”(30)
Neben den Künstlerateliers und Wohnungen wurden bereits am Anfang der 70er Jahre auch etliche inoffizielle Privatgalerien wichtig. Sie setzten fort, was in den anfangs typischen Hofausstellungen oder sogar Expositonen auf Schrottplätzen und Friedhöfen nur bedingt mglich war – ein zumindest ansatzweiser und nicht nur auf wenige Tage beschränkter Ersatz für die verwehrte Öffentlichkeit. Dabei konnten die neuen Privatgaleristen durchaus auf lokale Traditionen aufbauen: In Dresden hatten Atelierausstellungen und Privatinitiativen bereits eine längere Tradition, und in der thüringischen Domstadt führte die Erfurter Ateliergemeinschaft bis 1973 hochkarätige Personalausstellungen durch. Die 1974 in der Ostberliner Dunckerstraße mittels mehrerer Wanddurchbrüche geschaffene EP Galerie wurde zur Zugnummer unter den zahlreichen Neugründungen in den 70er Jahren. Dabei war sie zwar die bekannteste, aber längst nicht die erste und einzige, wie der irreführende Eigenname nicht ganz uneitel unterstellte. Neben und vor ihr setzten beispielsweise Inge Thiess-Böttner mit ihrer 1973 gegründeten Kellergalerie in der Dresdner Borsbergstraße oder die von 1970 bis 1974 existierende Feuchtraumgalerie in Halle lokale Akzente.
Zu einem regelrechten Gründungsfieber kam es aber erst im liberaleren Klima der 80er Jahre. Auf überregionales Interesse stieß vor allem die wegen ihrer professionellen Ausrichtung unter den neuen Privatgalerien weit herausragende Leipziger Galerie Eigen+Art, die, von Gerd Harry Lybke geleitet, nach der Wende zu einer der erfolgreichsten Galerien in Deutschland avancierte. Insgesamt können durch die Autoren mehr als 40 inoffizielle Privatgalerien und regelmäßige Atelierausstellungen bis 1989 nachgewiesen werden(31). Bisherige Darstellungen zu diesem Thema gingen bislang von 20 Alternativ-Galerien aus. Trotz der nachweislichen Verdoppelung dieser Zahl illustriert der gegenwärtige Recherchestand nur ansatzweise die Dimension eines der wichtigsten Teilgebiete der DDR-Subkultur.
Weitere einflußreiche Aktionsorte waren die zahlreichen bürgerlich inspirierten Haus- und Lesekreise. In Halle führte der Biochemiker Peter Bohley seit 1973 an jedem Freitag Lesungen bürgerlicher Literatur durch, die ihn in den Augen der Staatssicherheit zum Sicherheitsrisiko werden ließen und schließlich zu seiner rüden Ausbürgerung führten. Auch in Dresden und Leipzig, wo noch Reste bürgerlicher Lebensformen überlebt hatten, gab es eine Reihe von Kreisen, die ein alternatives Kulturleben initiierten – von Vorstellungen des Dresdner Puppenspielers Gottfried Reinhardt über Kostümfeste bis hin zu Lesungen ungeliebter Autoren, für deren Duldung und Organsiation man in der DDR-Provinz ganz schnell zum renitenten Staatsfeind erklärt werden konnte. Paris avancierte in diesen Kreisen zur Metapher eines anderen Lebens schlechthin. Eine nach innen gerichtete Gegenwelt, deren ästhetischer Anspruch nicht nur im krassen Widerspruch zur provinziellen Gestaltwelt der proletarisch genormten DDR-Mangelkultur stand, sondern deren Bewohner meist auch jegliches Interesse an einem unverstellten Blick auf das Leben in den imaginierten Zielräumen verloren hatten. Eine wohl einzigartige Melange enstand, die insgesamt für die DDR-Boheme typische Züge trug. Ihre Ingredienzen bestanden aus romantisierenden Vorstellungen über das Künstlerleben, Anleihen aus der Memoirenliteratur der französischen Boheme und schließlich aus zweiter Hand erworbenem Wissen um zeitgenössische Kunstprozesse. Das Ganze wurde vermischt mit dem Rohstoff Zeit, der in der DDR sogar noch häufiger als die bröcklige Braunkohle vorhanden war, mit dem die alten Kachelöfen geheizt wurde. In vielen Fällen führte diese idealisierende Rückbesinnung zu einer Biedermeierlichkeit, die aus heutiger Sicht allerdings nicht denunziert werden sollte, da sie damals ein identitätsprägendes Lebensgefühl entscheidend unterstützen half. Eine private Gegen-Welt als Rückzugsraum – mit Gründerzeit-Nippes neben dem Bauhaus-Freischwinger, mit dem scheinbar unvermeidlichen Trockenstrauß im Apothekerpreßglas, mit den oval gerahmten Neujahrsgrafiken über dem selbsteingefärbten Sofakissen und einer naiv-komödiantischen Lust an jedweden Kostümierungen aus dem Fundus von Uromas Kleiderschrank. Doch diese Mixtur war nicht wie im Westen das Produkt eines kurzzeitig aufbrausenden Spleens oder ein schnell vergängliches Diktum der Mode. Was hier geschah, hatte Bestand und prägte über Jahre sowohl die Interieurs als auch die kollektive Biografien.