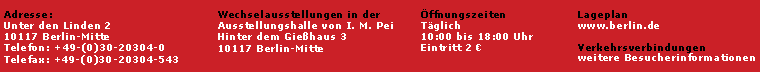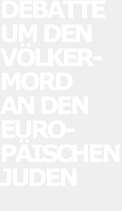 |
Anne Frank Im allgemeinen Bewußtsein des Landes spielt bis heute das verfolgte jüdische Kind, das bis zum Verrat in ihrem Versteck in der Prinsengracht 263 im Hinterhaus überleben konnte, eine tragende Rolle. Anne Frank, am 12. Juni 1929 in Frankfurt/Main geboren, floh 1933 mit ihrer Familie in die Niederlande. Dort wurden die Emigranten aus Deutschland auch aufgenommen. Als die Deportationen 1942 begannen, versteckten sich die Franks und andere in der Prinsengracht in Amsterdam. Die Untergetauchten wurden am 6. August 1944 verhaftet und Anne Frank über Westerbork nach Auschwitz und schließlich in das Lager Bergen-Belsen deportiert. Dort starb sie im März 1945 an Typhus. Die Institutionalisierung Anne Franks, die der Erinnerung nach in den Niederlanden behütet, geradezu unbeschwert leben und ihr Tagebuch schreiben konnte, beginnt am 3. Mai 1957 mit der Gründung der Organisation Anne Frank Haus. Diese eröffnete drei Jahre später in der Prinsengracht ein Museum, das Anne Frank Haus. Seitdem gehört das Versteck zu den bestbesuchten Museen Amsterdams. Die Universalisierung des Tagebuches begann aber nicht in den Niederlanden, sondern ging den Umweg über die USA. Dort erschien es 1952. Schon am Erscheinungstag konnten 45 000 Bücher verkauft werden. Noch bevor irgend jemand über Holocaust, Shoah oder über Auschwitz sprach, wurde das Tagebuch und das Schicksal Anne Franks zum Synonym für die Vernichtung der Juden und des Judentums durch die Nationalsozialisten. |
| 1947 veröffentlichte Anne Franks Vater, Otto Frank, eine gekürzte Tagebuchaus-gabe seiner Tochter. Die Zensur bezog sich hauptsächlich auf die Schilderung familiärer Konflikte sowie die Auseinandersetzung Anne Franks mit der eigenen Pubertät und Sexualität. Die niederländische Ausgabe trägt nicht den Titel „Tagebuch der Anne Frank“ sondern – ganz dem niederländischen Selbstbild geschuldet – „Het Achterhuis“. Auch Anne Franks Bild taucht auf dem Titel nicht auf. In den ausländischen Ausgaben wird der Titel zugunsten der Schreiberin geändert und lautet dort „Das Tagebuch der Anne Frank“. Damit wird sie aus der Gruppe der in der Prinsengracht Versteckten herausgehoben. Das Buch ist seitdem in vielen Auflagen erschienen, es wurde in ungefähr sechzig Sprachen übersetzt und in fünfundzwanzig Millionen Exemplaren verkauft. Das Bild von Anne Frank auf dem Titel ist zumeist das eines schmächtigen Mädchens in der Schulbank, mit einem Schreibheft vor sich. | |
| In den 70er und 80er Jahren gab es Angriffe von Neonazis, die an der Echtheit des Tagebuchs zweifelten. Die Fälschungsvorwürfe konnten, jeder Grundlage entbehrend, relativ schnell widerlegt werden. Dadurch entstand jedoch ein Gefühl für die Verletzlichkeit des Mythos: es gab Proteste gegen die angestrengte Untersuchung und sogar Anfragen im Parlament. Einen Schritt nach vorne bedeutete in diesem Zusammenhang das Erscheinen des (fast) vollständigen Tagebuches in einer kommentierten textkritischen Ausgabe von 1986. Diese Ausgabe änderte jedoch nichts daran, daß hauptsächlich jüdische Amerikaner die aus ihrer Sicht immer noch oberflächliche Darstellung bemängeln. Sie kritisieren die „Anne-Frank-Industrie“, auch die etablierten Einrichtungen wie das Anne Frank-Haus in Amsterdam oder den Anne Frank-Fonds in Basel, sowie die Vereinnahmung durch andere Gruppen und Institutionen. 2001 erschien eine weitere Ausgabe. |
|
Mit der Theaterfassung durch das Ehepaar Frances Goodrich/Albert Hackett und seiner Uraufführung am New Yorker Broadway 1955 begann zwar die Universalisierung, aber auch die später viel kritisierte „Kommerzialisierung“ von Anne Frank. Es gab nicht zu übersehende Wortlaut- und damit Bedeutungs-veränderungen, Kürzungen und sogar Einschübe neuer Passagen. Hier stand nicht die Person Anne Frank im Vordergrund, sondern eine vermeintliche Botschaft: „Trotz allem glaube ich noch an das Gute im Menschen.“ Kurz bevor die erste Verfilmung 1959 in die Kinos kam, widmete das US-Magazin Life den Tagebüchern und der Lebensgeschichte Anne Franks im August 1958 eine Titelgeschichte: Ihr Jugendtraum, das Leben möge sie eines Tages nach Hollywood führen, war damit – Ironie des Schicksals –, kurz davor, posthum in Erfüllung zu gehen. Auf dem Titelblatt wurde ein Ausschnitt aus der Tagebuchseite abgebildet, auf der Anne Frank eines ihrer Kinderphotos kommentierte und mit dem Hinweis auf Hollywood versah. |
|