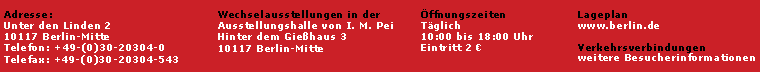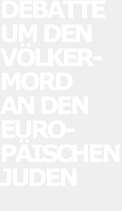 |
Dekonstruktion der Stereotypen
|
| Mit seinem „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“ stellte der Cartoonist Art Spiegelman mit den Mitteln des Comics und der provozierenden Darstellung der verschiedenen Völker Europas in Tiergestalt – Juden sind Mäuse, Deutsche Katzen, Polen Schweine usw. – die Konventionen der Holocaust-Darstellung in Frage. „Maus“ erzählt die bewegende Geschichte der Familie Spiegelman. Dieser Comic leitete eine dritte Phase der Erinnerungskultur ein. Spiegelman suchte die Ratlosigkeit der eigenen Generation zu lösen, sich unter dem Gewicht der Verbrechen und der Erfahrung der Elterngeneration bewegen zu können. | |
| In den 80er Jahren beginnt ein Wandel in der Thematisierung der Völkermord-problematik. Der kulturelle Bruch erfolgte 1985 mit der Ausstrahlung des Films „Shoah“ von Claude Lanzmann. Er hat das allgemeine Bewußtsein über den Völkermord zutiefst erschüttert. Lanzmann geht nicht nur zurück an die Orte, an denen die Konzentrationslager waren. Der Film nimmt die Symbolik der Zugreise auf, immer wieder beschwört die Fahrt auf den Gleisen den Sphärenwechsel vom Tod zum Leben. Lanzmann drehte dabei auch die heutigen Züge, die Anfahrten und die Bahnhöfe. Auf dem Plakat ist ein Still zu sehen, in der Lanzmann den Lokführer interviewt. Lanzmann schuf ein neues Genre: das filmische Denkmal, das frei von Voyeurismus die Opfer wie die Täter sprechen läßt. | |
| Die Dekonstruktion der Klischees ist seit den 90er Jahren zu einem Gebot der Generation der Enkel geworden. Alan Schechners Bild von 1993 dürfte eine der konsequentesten Arbeiten in diesem Sinne sein. Der Künstler hat sich eine bekannte Photographie von Margaret Bourke-White ausgesucht, die sie 1945 für das Magazin „Life“ im befreiten Konzentrationslager Buchenwald gemacht hat. Der britische Künstler fügte dieser allgegenwärtigen Photographie ein Bild von sich selbst hinzu . Er trägt ein gestreiftes Hemd, das die Streifenanzüge zitiert. Er steht, den Betrachter fixierend, vor den fast verhungerten Häftlingen und hält eine Dose „Diet-Coke“ - Inbegriff der westlichen Konsumkultur – dem Betrachter demonstrativ entgegen. Angesichts dieses Bildes stellt sich die Frage, warum und wofür die Photographie von Margret Bourke-White benutzt wird. Schechner will schockieren, doch seine Kritik geht tiefer. Er greift die „Holocaust-Industrie“ an und will die attackieren, die für die wahllose Aneinanderreihung der Motive, für die Erstarrung der Erinnerung verantwortlich sind. Und er wendet sich gegen die Behauptung, daß Photographien das Unsagbare, ja Unvorstellbare erklären könnten. | |
| Der Prozeß gegen Adolf Eichmann, die Strafsache 40/61, wurde am 11. April 1961 in Jerusalem eröffnet. Er wurde nach den Nürnberger Prozessen zum meist-beachteten Nachkriegsverfahren gegen führende Nationalsozialisten. Eine bis heute wichtige Frage ist, ob Adolf Eichmann ein seelenloser Bürokrat war, wie Hannah Arendt schrieb, oder ob es sich bei ihm um einen hasserfüllten Antisemiten handelte, der aus Überzeugung morden ließ, wie der israelische Anklagevertreter Gideon Hausner behauptete. Hannah Arendt verfolgte den Prozeß gegen Eichmann für das amerikanische Wochenmagazin „The New Yorker“. Ihr Buch „Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ bricht mit der Vorstellung, daß hinter dem Bösen eine dämonische Willenskraft steht. Ihre Thesen widersprachen nicht nur Hausner, sondern riefen weltweit Widerspruch hervor. Hannah Arendts These von Eichmanns „Banalität des Bösen“, wird in dem Film von Eyal Sivan und Rony Braumann diskutiert, beide in Israel geboren, nun aber in Frankreich lebend. Sie folgen Hannah Arendt und dekonstruieren die Sicht auf Eichmann, indem sie die These von der Banalität des Bösen übernehmen. Auf dem Cover der Videocassette ist das Bild Eichmanns zu sehen. Vor die Augen wurde eine Spielzeuglok mit roten Rädern montiert. Die Räder der Lokomotive sind Eichmanns Brillengläser. Da er nur noch durch die Lokomotive schauen kann, wird er quasi selbst zur Lokomotive, zum Motor des Mordes an den europäischen Juden. |
|