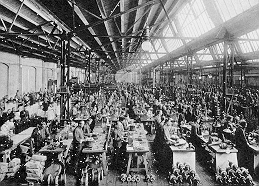AEG-Produktionsstätten
1908
links:
Kleinmotorenfabrik
rechts:
Versandlager
II
Dieses eigentümliche Gemisch aus rassentheoretischer und geschichtsphilosophischer Spekulation wirkt nicht nur auf den heutigen Leser, sondem wirkte sogar auf viele Zeitgenossen irritierend, denen Theorien dieser Art durchaus nicht unbekannt waren. Die Suche nach Anregungen und Einflüssen würde vermutlich eine Fülle von Material ergeben. Damit ließe sich jedoch keineswegs die Frage beantworten, was Walther Rathenau zur Formulierung dieser Theorien bewogen haben mag, und hier hilft vermutlich nur ein Blick auf die Biographie weiter. Der Weg, den er seit den in den neunziger Jahren geplanten, aber nicht verwirklichten Fluchtversuchen aus der bürgerlichen Welt von Handel und Industrie nahm, entsprach sehr genau der an seinen literarischen Äußerungen ablesbaren Entwicklung. Diese reichte vom Protest durch die Formulierung eines antibürgerlichen Leitbilds in Höre, Israel! über die Anerkennung der Tatsache, daß die moderne Welt die der Industrie ist und das antibürgerliche Ideal einer vergangenen und unwiederbringlich verlorenen Epoche angehört in Von Schwachheit, Furcht und Zweck, bis zum Nachweis der Notwendigkeit dieser Entwicklung in Zur Kritik der Zeit. Er hatte nach dem Bitterfelder Mißerfolg, auf dessen Höhepunkt 1897 Höre, Israel! erschienen war, im Vorstand der AEG nach dreijähriger Tätigkeit eine persönliche Niederlage hinnehmen müssen, als es ihm nicht gelungen war, für seinen Vorschlag einer Fusion der AEG mit den Nürnberger Schuckert-Werken eine Mehrheit zu finden; daß er fast gleichzeitig Höre, Israel! in den Impressionen erneut und diesmal unter vollem Namen veröffentlichte, gibt allein durch die zeitliche Koinzidenz einen Hinweis auf den Zusammenhang des Berufslebens mit dem literarischen Protest.