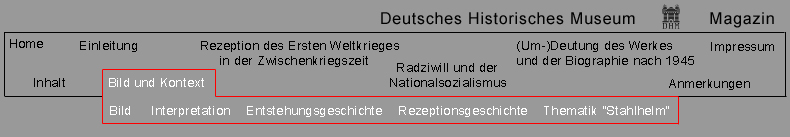
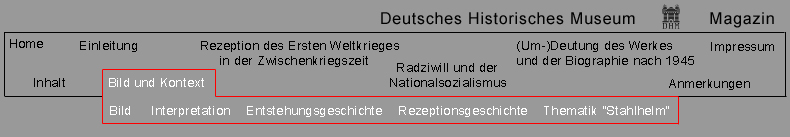 |
Interpretation
Radziwills Bildtitel und Komposition legen nahe, daß die Situation im "Grab im Niemandsland" sinnbildlich gemeint ist. Während des Ersten Weltkrieges hatte der Stahlhelm eine symbolische Bedeutung erhalten. Das veranschaulichen zwei Beispiele: Der sehr erfolgreiche Münchner Medailleur Karl Goetz (1875-1950) stellte auf der Rückseite seiner Gedächtnismedaille zum erstmaligen Einsatz von Sanitätshunden im Krieg einen Stahlhelm vor einem "Roten Kreuz" (Abb.1) dar. Dieser symbolisierte die verletzten und gefallenen deutschen Soldaten. Die kompositorische Anlage ist Radziwills "Grab" sehr ähnlich. In dem Ölgemälde "Sperrfeuer bei Douaumont" des Kriegsmalers Paul Segieth (Abb.2) sind die Hinterlassenschaften eines getöteten Soldaten auf dem umkämpften Schlachtfeld festgehalten. Im Vordergrund, an sehr exponierter Stelle, sind ein deutscher Stahlhelm, der Stumpf eines zerstörten Baumes und eine Handgranate zu sehen. Der Helm ist nicht säuberlich und akkurat mit der Öffnung nach unten aufgestellt, sondern achtlos auf die Seite gefallen. Er erinnert an seinen ehemaligen Besitzer, dessen Schicksal im Zustand des toten Baumes angezeigt wird: Den Soldaten hat es zerrissen, er ist ausgelöscht. 
Zeigt bei Segieth der zu Boden gestürzte Helm den Tod des Kämpfers auf dem Schlachtfeld an, erhält er bei Radziwill eine weitere Bedeutungsdimension. Wie bei Goetz hat der Stahlhelm auch hier seinen Platz nicht zufällig am Fuße des verwitterten Holzpfeilers, der wie ein Kreuz in den Himmel ragt. Denn mit Stahlhelm, Pfahl und Stacheldraht wird auf die Ikonographie von Golgatha und die Kreuzigung Christi angespielt. Demnach steht der Stahlhelm für den Totenschädel unter dem Kreuz auf dem Berg Golgatha, der Pfahl zitiert das Kreuz und der Stacheldraht die Dornenkrone. Einer Kreuzigungsszene verwandt, befindet sich der Helm wie der Totenschädel am Fuße des Pfahls und mahnt an die Auferstehung und Erlösung der Menschen. Ein anderes Gemälde von einem unbekannten Maler aus dem "Dritten Reich", das gleichfalls an den Soldatentod im Ersten Weltkrieg erinnert, belegt das Beharrungsvermögen dieser christlichen Sinnbilder bis ins "Dritte Reich". Die perspektivische Staffelung der Holzpfähle in die Tiefe des Bildraums ist in beiden Darstellungen dieselbe. Aus ähnlicher Perspektive sieht man einen toten Soldaten mit ausgebreiteten Armen im Stacheldrahtverhau. Wie der ans Kreuz geschlagene Christus scheint er am Pfahl zu hängen, das entblößte Haupt von einem Dornenkranz aus Stacheldraht gekrönt. Der Helm liegt vor ihm auf dem Boden. Selbst im Zweiten Weltkrieg war diese Pathosformel noch im Gebrauch, wie ein amerikanisches Beispiel illustriert. Der gefallene Soldat ist aufgebahrt wie Jesus Christus (Abb.3). Doch anders als in dem Bildbeispiel aus der Malerei des "Dritten Reiches" stellt Radziwill nicht den toten Körper aus, sondern beschränkt sich auf die Zeichen des Schreckens. Seine Zitate, die mit den aus der christlich geprägten Kunstgeschichte überlieferten Pathosformeln spielen, sind daher feinsinniger und nicht plakativ. 
Durch die Vertikalen zerfällt das "Grab im Niemandsland" in eine linke und eine rechte Bildhälfte. Links stehen Pfähle in den Farben Rot, Schwarz (oder tiefes Dunkelbraun) und Gold (oder Gelb). Rechts befinden sich die ausge leuchteten Pfähle, bei denen das "Grab" ist. Der Stahlhelm liegt rechts. Zufall? - Nur ein Pfahl auf der rechten Seite taucht in die lichte Himmelszone ein. Er überragt alle auf der linken Seite - und den Todesstreifen! Radziwills Signatur prangt auf einem hell angestrahlten Brett an der Schützen grabenwand genau unterhalb des Stahlhelms. Bei einer so ausgeklügelten Komposition muß es Absicht gewesen sein, daß gerade die rechte Bildhälfte schlaglichtartig ausgeleuchtet ist, während die linke Seite im Dunkeln verbleibt. |
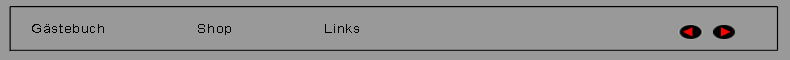 |