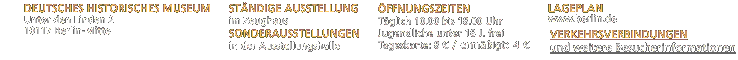Sammlungen des Deutschen Historischen Museums
Alltagskultur II › Kleidung/Textilien › Bestandsauswahlvorheriges Objekt | nächstes Objekt

- Titel: Schachthut eines sächsischen Bergbeamten
- Datierung: Ende 18. Jh./ Anfang 19. Jh.
- Material: Seide, Wolle, Metallborte
- Größe: H: 18 cm
- Inventar-Nr.: KTe 60/6
Der Schachthut entspricht den Erläuterungen zur Einführung eines „Parade-Berg-Habit(s)“ von 1768. Vom Beamtenstatus des Trägers zeugt der kurfürstlich-sächsische Wappenschild. In dessen Farben - Schwarz und Gelb – ist die seitlich angebrachte Bandrosette gehalten.

- Titel: Schachthut eines Bergmannes aus dem Mansfelder Kupferschieferbergbau
- Datierung: 1900 (um)
- Material: Wolle, Regeneratzellulose, Pappe, Leder, Hahnenfedern
- Größe: H: 14,5 cm (Hut), H: 33cm (Stutzen)
- Inventar-Nr.: U 80/2c-d
Den Federbusch, der den Schachthut optisch erhöht, durften Musikanten und Bergmänner höheren Ranges tragen. Die mauerkronenartig aufgebrachte Borte war in den Mansfelder Vorschriften von 1769 auch allen Arbeitern zuerkannt. Über der Stirnmitte das Wappen der Mansfelder Grafen mit gekreuztem Schlägel und Eisen dahinter, dem Symbol der Bergleute. Die Hüttenmänner hatten drei gekreuzte Werkzeuge als Emblem: Krummeisen, Hüttengabel und Stecheisen.
Abbau, Verhüttung und Veredelung von Mineralen in Sachsen verlangten hohe technische und finanzielle Aufwendungen und Verfügungsrechte über Land, Wälder, Wasserläufe. Bis ins 18. Jh. hinein bestimmten daher landesherrliche Bergordnungen über Bergbau und Hüttenwesen in Sachsen.
Das wirtschaftlich bedeutende Montanwesen bezog der absolutistische Landesherr seit dem ausgehenden 16. Jh. in seine Feste und Aufzüge, die er zu seiner Repräsentation veranlasste, mit ein. Berg- und Hüttenmänner wurden anlässlich solcher Bergparaden, die bei fürstlichen Besuchen im Revier oder bei Hofe in Dresden stattfanden, mit einer Paradekleidung ausgestattet. Sie orientierte sich an der alltäglich getragenen Arbeitskleidung.
Eine erste sächsische „Habitordnung“ regelte 1668 die bergmännische Arbeits- und Festtagskleidung. 1719 erschien eine weitere Vorschrift für die Aufzugstracht. Sie wurde 1768 modernisiert und stärker uniformiert.
Von 1719 an bestimmten die Farben Schwarz und Weiß das festliche bergmännische Erscheinungsbild: schwarzer Grubenkittel, Bergleder, weiße Hosen, grüner Schachthut, Kniebügel, Grubenlicht und Bergbarte. Über die vorgeschriebene Montur verfügte kaum ein Bergmann. Die Ausstattung musste neu gearbeitet oder bei anderen Revieren zusammengeborgt werden, um ihn „complett“ zu machen (Fritzsch, Bergmännische Trachten des 18. Jhs, Berlin 1957, S. 16).
Der Führungsschicht waren schwarze Puffjacken aus feinem Tuch vorgeschrieben. Stilistisch gehen sie auf eine kurze Jacke des 16. Jhs zurück, in die Puffärmel (daher die Bezeichnung „Puffjacke“) eingesetzt waren. Im Laufe der Jahrzehnte unterlag dieser Jackentypus immer wieder modischen Eingriffen. Doch blieben ihm die markanten Ärmel mit den reichen Verzierungen, Besätzen, Fransen oder Biesen erhalten. Das rückwärtig getragene, halbrund geschnittene Bergleder (auch als Gruben- oder Arschleder bezeichnet) ließ den Eindruck eines Justaucorps bzw. Fracks entstehen. Die Hüttenmänner trugen hellgraue Puffjacken und Bergleder bzw. weiße Kittel und Vorleder, dazu jeweils weiße Hosen.
Der steife, zylindrische Schachthut - für die Bergleute in Grün, für die Hüttenleute in Schwarz - demonstrierte Gruppenzugehörigkeit. Federbusch, Wappen und Stoffart sowie Anzahl, Breite und Qualität der aufgebrachten Borten wiesen auf ihre Stellung innerhalb des Bergstaates hin.
Andere Bergbaureviere nahmen die erzgebirgische Paradekleidung als Vorbild. So wurde beispielsweise 1769 im Mansfelder Kupferschieferbergbau eine entsprechende Trachtenreform durchgeführt. Nur die Farbe der Schachthüte unterschied sich von der des Erzgebirges: Sie war für Berg- und Hüttenmänner einheitlich Schwarz.
Im Zuge von Industrialisierung und Privatisierung im 19. Jh. wurde auch die landesherrliche Reglementierung des Berghabits obsolet. Manche Bergleute pflegten ihn noch in Knappschaftsvereinen oder bei Bergparaden, die örtliche Verkehrsvereine als historische Umzüge veranstalteten. Weit über die Grenzen Sachsens hinaus ist der festlich gekleidete Bergmann zur ikonographischen Erscheinung geworden.
Der festlich gekleidete Bergmann hat als Motiv in der erzgebirgischen Holzschnitzkunst überdauert. Seine besondere Beziehung zum Licht, das ihm seine Arbeit in der Tiefe der Erde überhaupt ermöglichte, prädestinierte ihn zum Lichthalter. Vorbild für die einfache gedrechselte und bemalte Ausführung werden Metallleuchter gewesen sein. Solche figürlichen Altar- oder Knappschaftsleuchter aus Zinn waren seit dem 17. Jh. verbreitet.