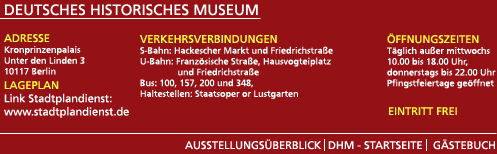|
Vom Ketzer- zum Hexenprozess Inquisition, Ketzerverfolgung und
Hexenprozesse - mit diesen Schlagworten wird gewissermaßen
eine zeitliche Abfolge in der Identifizierung und Aburteilung von
religiösen oder gesellschaftlichen Dissidenten über einen
Zeitraum von einigen hundert Jahren umrissen. Zusammen mit der Zulassung
der Folter zur Geständniserzwingung gilt die Ketzerinquisition
als prozessrechtliches Fundament für die späteren Hexenprozesse.
Tatsächlich ist die Entwicklung jedoch nicht so gradlinig verlaufen,
wie es auch der Titel dieses knappen Überblicks suggeriert.
Erst die Verschmelzung verschiedener geistes- und rechtsgeschichtlicher
Strömungen führte zur Herausbildung eines theologisch
und juristisch begründeten Hexereibegriffs, der unmittelbar
an den Ketzerbegriff anknüpfte. Die Ketzerinquisition musste
aber nicht zwangsläufig im Hexenprozess münden. Welches
waren die Knotenpunkte beziehungsweise ‚Scharniere', an denen
die Entwicklung auch anders hätte verlaufen können? Welche
Autoren konnten sich mit ihren Auffassungen durchsetzen? Zunächst gilt es jedoch, zwischen
dem kanonischen (geistlichen) Recht und dem weltlichen Recht zu
unterscheiden sowie der Frage nachzugehen, wie es zur Ausbildung
der Vorstellung von Hexerei kam und worauf sie sich gründete.
Geschaffen wurde der Inquisitionsprozess durch Papst Innozenz III.
(† 1216) als eine Art Disziplinarverfahren gegen hochrangige
Kleriker wie Erzbischöfe, Bischöfe oder Äbte, denen
man Amtsmissbrauch, Simonie, Verstoß gegen die Sitten oder
Abweichung von der Glaubenslehre (Häresie/Ketzerei) vorwarf.
Die bis zu diesem Zeitpunkt angewandten rechtlichen Maßnahmen
erschienen dem um eine Reform der Kirche bemühten Innozenz
nicht ausreichend. Zur Eröffnung eines Akkusationsprozesses
(accusare = anklagen) fehlte vielfach ein Kläger, der bereit
war, gegen solche mächtigen Personen aufzutreten. Zudem trug
der Kläger in diesem Verfahren die ganze Beweislast und musste
im Falle einer Niederlage vor Gericht selbst mit Bestrafung rechnen.
Auch der Infamationsprozess (infamia = Ehrlosigkeit) erwies sich
zunehmend als ungeeignet. Zwar waren die Kirchenoberen verpflichtet,
im Falle eines Gerüchts über den schlechten Ruf eines
Klerikers ein Infamationsverfahren von Amts wegen (ex officio) einzuleiten,
der Beklagte konnte sich jedoch durch einen Eid, der von einer unterschiedlichen
Anzahl von Eideshelfern unterstützt werden musste, von den
Vorwürfen reinigen. Dieser unbefriedigenden Situation sollte
das von Innozenz III. ausgebildete Inquisitionsverfahren Abhilfe
schaffen. Die wesentlichen Merkmale dieses Prozesses waren: - Einleitung des Verfahrens von Amts
wegen (Offizialmaxime). - Untersuchung (inquisitio) zur Ergründung
der materiellen Wahrheit (Instruktionsmaxime); insbesondere der
Zeugenbefragung kam das Gewicht eines Beweismittels zu. - Beschuldigungen konnten nicht mehr
durch einen Reinigungseid ausgeräumt werden. - Die Angeklagten verfügten
über weitgehende Verteidigungsmöglichkeiten (Bekanntgabe
der Anklagepunkte und der Namen der Zeugen, Zulassung von Eingaben). Dieses Verfahren, das seine gemeinrechtliche
Sanktion durch das 4. Laterankonzil im Jahre 1215 erfuhr, war keine
völlige Neuschöpfung. Vielmehr fügte Innozenz III.
verschiedene, bereits im römischen Recht und in der von dem
Bologneser Mönch Gratian († vermutlich 1150) angelegten
kirchlichen Rechtssammlung (Decretum Gratiani, 1140) vorhandene
Elemente zusammen beziehungsweise arbeitete sie für seine Zwecke
aus. Zwar handelte es sich bei der Inquisition zunächst nur
um eine prozessrechtliche Korrektur des unzulänglichen Infamationsverfahrens,
aber damit wurde ein Instrumentarium geschaffen, das durch einige
entscheidende Änderungen auch gegen andere Feinde der Amtskirche
eingesetzt werden konnte: die Ketzer. Seit der Entstehung des Christentums
vertraten Einzelne oder Gruppen immer wieder Positionen, die von
der anerkannten Glaubenslehre abwichen. Mit der Übernahme als
Staatsreligion im Römischen Reich erhielt die Bekämpfung
der Häresie eine andere Qualität. Ein Vergehen gegen den
Glauben war zugleich ein Vergehen gegen die kaiserliche Majestät
und damit gegen den Staat; es wurde mit Verbannung, Infamie, Konfiskation
und in schweren Fällen auch mit dem Tod geahndet. Gerade die
Rezeption dieses Gedankens sollte infolge des vermehrten Auftretens
häretischer Gruppen seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
eine wichtige Rolle spielen. Im Mittelalter lag die Verfolgung
von Ketzern lange Zeit in den Händen bischöflicher Sendgerichte;
der Reinigungseid oder bei Laien auch das Ordal (Gottesurteil) blieben
bis zum 4. Laterankonzil anerkannte Mittel, um sich vom Vorwurf
der Häresie zu reinigen. Die weltlichen Fürsten zeigten
zunächst kaum Interesse, sich an einer Verfolgung der Ketzer
zu beteiligen. Dies änderte sich erst im letzten Drittel des
12. Jahrhunderts. Das 3. Laterankonzil (1179) unter Papst Lucius
III. († 1185) erteilte der weltlichen Macht die Erlaubnis zur
Konfiskation von Ketzerbesitz. Kurz danach, im Jahre 1184, kam es
in Verona zu einem Zusammengehen zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa
(† 1190) und Lucius III. in der nun als vordringliche Gemeinschaftsaufgabe
angesehenen Bekämpfung der Häretiker. Zwar ist von den
dort beschlossenen Gesetzen die kaiserliche Order (constitutio)
nicht mehr erhalten, wohl aber das päpstliche Gegenstück,
das Dekretale Ad abolendam. Darin wurden die Bischöfe zu regelmäßigen
Visitationen und Befragungen in den Gemeinden verpflichtet, um Ketzer
ausfindig zu machen und abzuurteilen. Kamen sie dieser Aufgabe nicht
nach, mussten sie mit einer dreijährigen Amtsenthebung rechnen. Innozenz III. hielt im wesentlichen
an dieser Methode der Ketzerverfolgung fest, fügte aber dem
Delikt der Häresie neue Aspekte hinzu, die sich einige Jahrzehnte
später so verheerend auswirken sollten. So bezeichnete er in
seiner Dekretale Vergentis (1200) Ketzerei als crimen laesae majestatis
divinae (Verbrechen gegen die göttliche Majestät). Doch
erst einige Jahre nach Innozenz' Tod († 1216) und nach Beendigung
des von ihm angeregten Ketzerkreuzzuges im Süden Frankreichs
(1209-1229) kam es zur Ausbildung der Ketzerinquisition als Sonderform
des Inquisitionsprozesses. Eine entscheidende Etappe in dieser Entwicklung
ist das erste Auftreten von Inquisitoren, von ‚Sonderermittlern',
die mit besonderen päpstlichen Vollmachten ausgestattet waren.
In der Literatur lässt man diese Phase mit dem Jahr 1231 beginnen,
als Konrad von Marburg († 1233) für Deutschland und Robert
le Bougre († vor 1263) für Frankreich zu Ketzerrichtern
ernannt wurden, deren einzige Aufgabe im Aufspüren und in der
Aburteilung von Häretikern bestand. Allerdings stießen
ihre, meist in Konkurrenz zur bischöflichen Gerichtsbarkeit
stehenden Nachforschungen noch auf Widerstand in den Diözesen.
Konrad wurde im Juli 1233 in der Nähe seines Heimatortes von
aufgebrachten Rittern erschlagen, während Robert nach heftigen
Vorwürfen gegen seine Willkürjustiz zu lebenslanger Klosterhaft
verurteilt worden war. Diese ersten Inquisitoren hatten noch nicht
die Befugnisse und prozessualen Mittel, wie sie einige Jahre später
im so genannten summarischen Verfahren (‚kurzer Prozess') zur
Verfügung standen. Dazu bedurfte es noch der Aufbereitung durch
geistliche und weltliche Rechtsgelehrte. In den kaiserlichen Ketzergesetzen
von 1219/1220 wurde dann erstmals auf Reichsgebiet die Häresie
zum Majestätsverbrechen erklärt und die Verbrennung als
Strafe festgesetzt. Friedrich II. († 1250) nutzte diese Bestimmungen
zunächst, um gegen aufsässige oberitalienische Kommunen
vorzugehen. Deren Widerstand bezeichnete er in der Constitutio contra
haereticos Lombardiae (Gesetz gegen die Häretiker der Lombardei,
1224) kurzerhand als häretisch motiviert. Damit vergingen sie
sich gegen ihn, den Kaiser, und gegen Gott. Da bei Schwerverbrechen,
zu denen Hochverrat zweifellos zählte, schon das antike römische
Recht die Folter erlaubte, fand dieses fatale Mittel der Beweiserhebung
Eingang in die Ketzerverfolgung. In der von Friedrich II. initiierten,
umfassenden Gesetzgebung für das Königreich Sizilien (Konstitutionen
von Melfi, 1231) flossen alle bis dahin im Rahmen der Ketzerverfolgung
ausgearbeiteten Rechtspositionen zusammen: Das Dekretale Vergentis
von Innozenz III. wurde wörtlich übernommen, Majestätsverbrechen
mit Verbrechen gegen die göttliche Majestät gleichgesetzt,
die Folter als Mittel der Wahrheitsfindung erlaubt und der Feuertod
als Strafe festgeschrieben. Ein Jahr später erlangten diese
Regelungen im gesamten Gebiet des mittelalterlichen Deutschen Reiches
Geltung. Auch in der Kanonistik kam es zu
einer Vereinheitlichung der Rechtsentwicklung des weltlichen und
des geistlichen Bereiches. 1234 ließ Papst Gregor IX. (†
1241) die kaiserlichen Ketzergesetze in seine Dekretalensammlung
aufnehmen. Damit wurde die Todesstrafe für Ketzer auch kirchlich
sanktioniert. Zudem übernahm er den von Innozenz III. aufbereiteten
Inquisitionsprozess, führte ihn aber unter den Ausnahmeverfahren
(processus extraordinarius) an. Ausnahmeverfahren erlaubten außergewöhnliche
Mittel. Diese wurden dann schließlich mit der Bulle des Papstes
Innozenz IV. († 1254) Ad extirpanda (1252) festgeschrieben: - Einleitung des Verfahrens von Amts
wegen durch besonders bevollmächtigte Inquisitoren. - Zur Verfahrenseinleitung war eine
einfache Denunziation ausreichend; durch Unterlassung einer Anzeige
machte man sich selbst strafbar. - Als Ankläger und Zeugen waren
alle Personen zugelassen, also auch solche, die in einem ‚normalen'
Verfahren keine Rechtsfähigkeit besaßen (Frauen und Kinder
sowie Kriminelle, Ehrlose, Komplizen, Unfreie etc.). - Zulassung der Folter als Beweismittel
zur Geständniserzwingung. - Verurteilung war auf bloßen
Verdacht hin möglich. - Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten
der Angeklagten (Namen der Zeugen durften geheim bleiben; der Richter
brauchte Advokaten nicht zuzulassen; zudem konnten die Advokaten
durch ihre Tätigkeit selbst in den Verdacht geraten, Ketzer
zu unterstützen). - So genannte relapsi (ursprünglich
vom Häresieverdacht gereinigte, aber rückfällige
Ketzer) waren unverzüglich der weltlichen Gerichtsbarkeit zur
Exekution zu überantworten. Zwar betonte Innozenz IV., dass Wiedergutmachung
eines Schadens, Sühne und Buße Vorrang vor Strafe habe,
aber angesichts der als existentielle Bedrohung empfundenen häretischen
Bewegungen zielte die Ketzerinquisition eindeutig auf die Vernichtung
dieser Menschen. Die Verfolgung von Ketzern oblag also in erster
Linie der Kirche, die Prozesse wurden vor geistlichen Richtern geführt,
und allein die Vollstreckung des Urteils fiel dem weltlichen Arm
zu; durchaus anders verlief die sich im Spätmittelalter entwickelnde
Hexenverfolgung. Wie kam es zur Ausbildung der Vorstellung
von Hexerei und worauf gründete sie sich? Weder die Bibel noch
die Römer kannten den Begriff der Hexe oder des Hexenmeisters.
Allerdings war der Glaube an Zauberer und die Wirkung magischer
Handlungen offenbar in allen Kulturen und zu allen Zeiten vorhanden.
Bereits im Zwölftafelgesetz, den ältesten römisch-rechtlichen
Strafbestimmungen, finden sich Verbote von Schadenzauber und Zauberflüchen.
Verstarben Menschen infolge von Zauberei, so stand darauf der Tod;
konnte eine Schädigungsabsicht nicht nachgewiesen werden, sollten
die Täter weniger hart (ohne, dass dies näher spezifiziert
war) bestraft werden. Nach einer kaiserlichen Verordnung aus der
Zeit Konstantins des Großen († 337) waren Schadenzauber
sowie Erweckung sexueller Begierden mit Hilfe von Zauberei ebenfalls
mit der Todesstrafe zu ahnden, während die Anwendung magischer
Heilmittel als durchaus nützlich angesehen wurde. Kaiser Constantius
führte dann 357 generell die Exekution durch das Schwert für
alle zauberischen Praktiken und für Wahrsagerei ein. In den
Quellen werden Zauberer und Wahrsager meist allgemein als malefici
(male facere = Böses tun) bezeichnet. Bestimmungen gegen Schadenzauber
- meist Ernte- oder Saatzauber - existierten ebenfalls in den Volksrechten
und Rechtssammlungen des Mittelalters, die eine Komposition (Schadensausgleich
durch Sühnegeld) und in Fällen von Nichtleistung des Ausgleichs
den Feuertod vorsahen. Für die Hinrichtung von Zauberern und
Zauberinnen, mitunter auch für Fälle von Lynchjustiz,
gibt es das gesamte Mittelalter hindurch einzelne Beispiele. Aber
die Verurteilung erfolgte nur wegen Schadenzauber. Dämonen
spielten in der magischen Volkskultur des Mittelalters zunächst
offenbar keine Rolle. Damit aus einer "Zauberin" eine
"Hexe" wurden, bedurfte es noch der Durchsetzung der Positionen
einflussreicher geistlicher Autoren. Mit der immer wieder zitierten Schlüsselstelle
aus dem Bundesbuch im Alten Testament "Eine Zauberin sollst
Du nicht leben lassen" (Exodus 22, 17) - so die korrekte Übersetzung
des hebräischen Originals - erhielt die Verfolgung solcher
Menschen gewissermaßen göttliche Autorität und Auftrag.
Gemeint waren hier Personen, die heidnische Praktiken betrieben
wie Astrologie, Totenbeschwörung und Magie, um deren Bekämpfung
sich das Christentum von Anfang an bemühte. Die Kirche sah
im Schadenzauber, den sie für durchaus real hielt, einen Beweis
für den Götzendienst der Zauberer und Zauberinnen. Auf
diesen Grundlagen entwickelte der Hl. Augustinus († 430) seine
verhängnisvolle Theorie des Teufelspaktes. Seiner Ansicht nach
bereite es dem Teufel regelrechte Freude, mit seinen ‚Gehilfen',
den Dämonen, Menschen zu Übeltaten zu verleiten. Dazu
schlichen sich die Dämonen mittels ihrer luftigen Körper
in Schlafende; lüsterne Nachtdämonen (so genannte incubi)
stellten Frauen nach. Durch den Pakt mit dem Teufel/Dämon erhielten
Menschen die Möglichkeit, sich in Tiere zu verwandeln oder
Wetterzauber und anderen Schadenzauber zu betreiben. Das Vorgehen
der Kirche gegen heidnische Vorstellungen im Früh- und Hochmittelalter
war allerdings noch wenig beeinflusst von den dämonologischen
Vorstellungen des Hl. Augustinus. Zwar wurde die Existenz eines
teuflischen Zauberwesens nicht prinzipiell in Frage gestellt, der
Glaube daran aber doch weitgehend als Aberglaube verurteilt, der
durch Kirchenstrafen wie Bußen oder - in schweren Fällen
- durch Ausschluss aus der Gemeinschaft geahndet werden sollte.
Am deutlichsten bringt diese Position der Canon Episcopi, eine Zusammenstellung
des Synodal- und Kapitularienrechtes, zum Ausdruck, den Regino von
Prüm († 915) im Jahre 906 für den Trierer Erzbischof
Ratbod († 915) verfasst hatte. Darin wird unmissverständlich
der Glaube an Zauberei und Nachtfahrten der Göttin Diana mit
ihrem Gefolge als heidnische Irrlehre und Einbildung verurteilt.
Über Burchard von Worms († 1025) und Ivo von Chartres
(† 1115/1116) fand der Canon Episcopi Aufnahme in die kanonische
Rechtssammlung des Gratian und blieb bis zum 13. Jahrhundert die
herrschende Auffassung. In diesen weitgehend harmlosen Bahnen
hätte die Entwicklung weiter verlaufen können, wenn nicht
der althergebrachte Zauberglaube von den Gelehrten der Hochscholastik
- allen voran Thomas von Aquin († 1274) - mit der spätantiken
Dämonenlehre in Zusammenhang gebracht worden wäre. Anknüpfend
an die Teufelspakttheorie des Hl. Augustinus und unter Berufung
auf mehrere Bibelstellen über die Gefährlichkeit der Zauberer
entwickelte Thomas von Aquin die Vorstellung von einer teuflischen
‚Gegenkirche', die schärfstens bekämpft werden müsse.
Demnach herrsche der Teufel als gefallener Engel mit Duldung Gottes
über einen Dämonenstaat. Seinen Anhängern unter den
Menschen, den von Gott abgefallenen Zauberern und Wahrsagern, verleihe
der Teufel übernatürliche Kräfte, mit deren Hilfe
diese ihre Mitmenschen schädigen konnten. Der Pakt werde durch
Geschlechtsverkehr der Zauberer und Zauberinnen mit männlichen
und weiblichen Nachtdämonen (incubi und succubi) bekräftigt,
aus dem sogar Teufelskinder hervorgehen könnten. Mit ihrem
Abfall vom christlichen Glauben und dem Pakt mit dem Teufel machten
sich die Zauberer der schwersten Untat schuldig: des Verbrechens
gegen die göttliche Majestät. Damit geraten nun die Ketzer
wieder in den Blick. Hervorgerufen durch das starke Anwachsen
der Ketzerbewegungen in Südfrankreich und Oberitalien entstand
als prozessrechtliche Neuerung die Ketzerinquisition, die eine leichtere
und effektivere Bekämpfung dieser Gruppen ermöglichte.
Zur Aufrechterhaltung der Verfolgungsanstrengungen war die Kirche
bemüht, die Gefährlichkeit der Häretiker für
die etablierte Ordnung in immer grelleren Farben zu malen. So unterstellte
man ihnen magische Praktiken, Teufelsanbetung, Opferung von Neugeborenen
und wollüstige Ausschweifungen. All dies geschehe in nächtlichen
Versammlungen, auf denen der Teufel in Menschen- oder Tiergestalt
erscheine. In diesem Glauben an das Treiben der Ketzersekte liegt
die Keimzelle für die späteren Vorstellungen des Hexensabbats.
Jetzt war es nur noch ein kleiner Schritt, den traditionellen Zauberglauben
mit Häresie in Verbindung zu bringen. Denn wenn Ketzer Schadenzauber
verübten und den Teufel anbeteten, wenn Zauberei nur durch
Glaubensabfall mit Hilfe des Teufelspaktes bewerkstelligt werden
konnte, dann hatte man es in beiden Fällen mit ähnlich
schweren Verbrechen zu tun. Die Zauberei wurde zu einem Sonderfall
der Ketzerei. Da war es nur folgerichtig, dass man auch den Zauberern
vorwarf, ihre Praktiken nächtens nach Art einer ‚organisierten
Untergrund-Sekte' zu betreiben. Allmählich kristallisierte
sich mit Schadenzauber, Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft und geheimen
Versammlungen ein neuer Verbrechenstatbestand heraus: das crimen
magiae (Verbrechen der Zauberei), das als crimen exceptum (außerordentliches
Verbrechen) geradezu die Aufmerksamkeit der Ketzerinquisitoren verlangte. Ein weiteres Mosaiksteinchen in dieser
Entwicklung fügte Papst Johannes XXII. († 1334) hinzu.
In seiner aus dem Jahr 1326 stammenden Bulle Super illius specula
ordnete er an, dass Schadenzauber nach den Strafbestimmungen für
Ketzer zu ahnden sei. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts gewann die
Vorstellung einer Zauberersekte immer mehr an Boden. Ein Mann der
Praxis, der Dominikaner und Inquisitor Nicolaus Eymericus (†
1399), fasste in seiner Schrift Directorium Inquisitorum (gedruckt
1503), einem Handbuch für Kollegen, systematisch die den Zauberern
zur Last gelegten Verbrechen zusammen. Zu großen Verfolgungen
von Zauberern durch die Inquisition kam es erstmals zwischen 1320
und 1350 in Südfrankreich. Seit der Wende zum 15. Jahrhundert
folgten Prozesse gegen ‚Teufelsbündler' und ‚Hexensekten'
in der Schweiz, wiederum in Südfrankreich, Nordostspanien,
den französischen Alpen, der Dauphiné, Savoyen und Burgund;
um die Mitte des Jahrhunderts fanden auch vereinzelte Verfolgungen
in Lothringen und der Erzdiözese Trier statt. Der Begriff "Hexe" erscheint
erstmals in einem deutschsprachigen Gerichtstext im Jahre 1419 in
Luzern. Auch wenn sich diese Bezeichnung natürlich nicht überall
durchsetzte und in anderen Sprachräumen andere Begriffe benutzt
wurden (zum Beispiel in Frankreich sorcière oder in Italien
strega), so bestätigt das Auftauchen dieses Terminus doch,
dass ein Wahrnehmungs- und Substanzwandel gegenüber dem alten
Begriff der Zauberei stattgefunden hat. Während in den früheren
Schadenzauberprozessen einzelne Delikte zur Aburteilung gelangten,
wurden nun Teufels- und Dämonenlehre, Volksaberglauben, zauberische
Praktiken, Vorstellungen vom nächtlichen Flug der Unholde und
von den Ketzersabbaten zu einem "rechtlichen kumulativen häretischen
Hexenbegriff" subsumiert. Hexen handelten nicht als Individuen,
sondern als Mitglieder einer großen Verschwörung. Die
ihnen zur Last gelegten Übeltaten verdichteten sich immer mehr
zu fünf Kerndelikten - Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Hexenflug,
Hexensabbat und Schadenzauber -, die von allen Hexen gemeinsam begangen
wurden. Darin liegt auch die große Bedeutung, die der durch
Folter erpressten Angabe von Namen vermeintlicher Mittäter
in den Hexenprozessen zukam. Denn zur Verschwörung bedurfte
es Komplizen auf dem Hexensabbat. In der Entwicklung des neuen, rechtlich
und theologisch begründeten Hexenbegriffs gilt die Spanne von
1435 bis 1500 als entscheidendes Stadium, wobei die Erfindung des
Buchdrucks eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Verbreitung
dieses Gedankengutes spielte. Die in diesem Zeitraum entstandenen
Traktate des Wiener Theologieprofessors und Dominikaners Johannes
Nider († 1438), des französischen Inquisitors Nicolas
Jacquier († 1472) oder des deutschen Arztes Johannes Hartlieb
(† 1468) trugen zur Festigung dieses Konstrukts bei. Der entscheidende
Durchbruch der Hexenlehre sollte aber dem berüchtigten Hexenhammer
(Malleus Maleficarum) aus dem Jahre 1487 vorbehalten bleiben. Mit
dieser systematischen Zusammenfassung der Hexenlehre des Dominikaners
Heinrich Kramer (genannt Institoris, † 1505) findet die scholastische
Diskussion ihren Abschluss. Kramer hatte den Hexenhammer als Kommentar
zur Bulle Papst Innozenz' VIII. († 1492) Summis desiderantes
affectibus (1484), die auch der Buchausgabe vorangestellt ist, verfasst.
Mit der Bulle waren Kramer und sein Kölner Mitbruder Jakob
Sprenger († 1495) zu päpstlichen Inquisitoren in Deutschland
bestellt worden, um gegen das Verbrechen der teuflischen Zauberei
vorzugehen. Bei ihren Nachforschungen in den Diözesen stießen
die Inquisitoren aber auf den Widerstand der Amtskirche. Der Bischof
von Brixen, Georg Golser († 1489), hielt Kramer offenbar für
nicht ganz zurechnungsfähig und verwies ihn im Jahre 1486 des
Landes. Wohl aus diesen Erfahrungen und als Rechtfertigung seiner
von ihm vertretenen Hexenlehre schrieb der Inquisitor den Hexenhammer. Das Buch ist in drei Teile gegliedert.
Die ersten beiden Teile befassen sich mit der ‚Realität'
der Hexen und ihrer vermeintlichen Verbrechen (Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft,
Hexensabbat und Schadenzauber). Eine bedeutende Neuerung gegenüber
der scholastischen Tradition ist die Verengung der Hexereivorstellung
auf Frauen. Hier tritt dem Leser ein abstruses Sammelsurium von
Aberglaube, Wahnvorstellungen und Frauenhass entgegen. So doziert
Kramer, dass es in der Natur der Frauen liege zu lügen, dass
fast sämtliche Reiche der Welt durch Frauen zerstört worden
seien oder dass Frauen weniger gläubig und daher anfälliger
für die Versuchung durch den Teufel seien, denn schließlich
- so die krude Etymologie - komme das Wort femina (Weib) von fe
minus (fides mina = geringgläubig). Als besonders folgenreich erwies
sich der dritte Teil des Hexenhammer der dem prozessualen Verfahren
der Hexenverfolgung gewidmet war. Durchaus korrekt stellte Kramer
zunächst fest, dass Inquisitoren nur dann gegen Hexen vorgehen
könnten, wenn es in ihren Verbrechen einen Bezug zur Ketzerei
gebe. Zur Entlastung der Inquisitoren und der Bischöfe, aber
auch wegen der immensen Gefahr, die von den Hexen ausgehe, empfahl
er der weltlichen Gerichtsbarkeit dringend, sich mit diesem Verbrechen
zu beschäftigen. Dazu diskutierte er drei mögliche Verfahrensarten:
Den Akkusationsprozess hielt er für ungeeignet, da dem privaten
Kläger die Beweislast aufgebürdet war. Erfolgversprechender
erschien ihm die Einleitung eines Verfahrens von Amts wegen aufgrund
einer Denunziation. Das probateste Mittel sah Kramer jedoch im summarischen
Ketzerinquisitionsprozess. Und hier zählte er das gesamte Arsenal
an Ausnahmeregeln und Sondervollmachten auf, das den Ketzerrichtern
seit der Mitte des 13. Jahrhunderts zur Verfügung stand. Dementsprechend
einfach war die ‚Überführung' der Hexen. Neben Zeugen
und Indizien kam vor allem dem durch die Folter erzwungenen Geständnis
die entscheidende Beweiskraft zu. Und für den Einsatz der Tortur
gab es in einem Ausnahmeverfahren (processus extraordinarius) kaum
rechtliche Hürden. Kramers Sorge, die Hexen könnten durch
die Hilfe der Dämonen der Folter widerstehen, führte ihn
zu dem Gedanken, dass ein Richter eine Hexe auch ohne Geständnis
verurteilen solle, wenn er von deren Schuld überzeugt sei.
Das entsprach ebenfalls der aus der Ketzerinquisition bekannten
Verdachtsstrafe. Da die Hexen nicht nur geistige Verbrechen begingen,
sondern durch den Schadenzauber materielle Schäden verursachten,
forderte Kramer die weltlichen Richter ausdrücklich auf, dieses
nach dem gemeinen säkularen Recht unzulässige (Ausnahme-)Verfahren
anzuwenden. Damit förderte er nachhaltig einen Trend, der seit
etwa 1400 zu beobachten ist: eine allmähliche Zunahme der Hexenprozesse
vor weltlichen Gerichten, während sich die geistliche Gerichtsbarkeit
aus diesen Verfahren langsam zurückzog. Entscheidend begünstigt durch
Buchdruck und sinkende Papierpreise erlebte die gelehrte Diskussion
zum Hexenglauben im 16. Jahrhundert einen starken Anstieg. Auf die
in der Forschung immer noch kontrovers geführte Debatte, welche
Auswirkung die Reformation auf die Hexenverfolgung gehabt hat, kann
hier nicht näher eingegangen werden. Etwa zeitgleich mit der
Reformation meldeten sich jedoch erste kritische Stimmen aus beiden
Lagern. So lehnten etwa der Arzt und Philosoph Agrippa von Nettesheim
(† 1535) oder der Humanist Erasmus von Rotterdam († 1536)
den Glauben an Hexerei dezidiert ab, eine Auffassung, die auch einige
Reichsstädte wie Nürnberg oder Territorien wie die Landgrafschaft
Hessen vertraten. Die schärfste Kritik stammte aus der Feder
des klevischen Arztes Johann Weyer († 1588), der in seiner
Schrift Über die Blendwerke der Dämonen Hexenprozesse
als "Blutbadt der unschueldigen" anprangerte. Durchgesetzt
haben sich allerdings die Befürworter der Hexenlehre. In dem
Traktat De la démonomanie des sorciers (Von der Teufelsmanie
der Hexen und Hexenmeister) bot der berühmte französische
Staatsrechtslehrer Jean Bodin († 1596) mit großer Verve
eine Zusammenfassung des vermeintlichen Wissens über Hexerei.
Weitere führende Dämonologen waren der Jesuit Martin Del
Rio († 1608), der lothringische Generalprokurator Nicolas Remy
(† 1612) und der Trierer Weihbischof Peter Binsfeld (†
1598). Sie beriefen sich direkt oder indirekt auf die damals wie
heute juristisch und theologisch anfechtbaren Argumente des Hexenhammer.
Ein wichtiges Bindeglied für die Rezeption der Überlegung
Kramers, die Hexenverfolgung in den Bereich der weltlichen Gerichtsbarkeit
zu verlagern, bildete der Layenspiegel des pfalz-neuburgischen Landvogts
Ulrich Tengler († 1509/1510). In dieser Zusammenstellung des
säkularen Rechts befasste sich Tengler auch mit der angemessenen
Bestrafung der Hexerei, wobei er sich an den Vorgaben des Hexenhammer
orientierte. Eine andere Richtung schlug das wichtigste
deutsche Strafgesetzbuch jener Zeit, die Constitutio Criminalis
Carolina, die Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. (†
1558) von 1532, ein. Ausschließlich in römisch-rechtlicher
Tradition argumentierend wurde dort in Artikel 109 festgelegt, dass
nur bei erwiesenem Schadenzauber - sämtliche andere ‚Hexenverbrechen'
sind nicht Gegenstand des Gesetzes - die Verurteilung zum Scheiterhaufen
erfolgen durfte. Strafwürdig war zwar bereits eine beabsichtigte
Schädigung, trat diese aber nicht ein, lag eine Strafzuweisung
unterhalb der Todesstrafe im Ermessen des Richters. Zum Beweis eines
erfolgreichen Schadenzaubers bedurfte es entweder der Bestätigung
zweier Tatzeugen, was bei einem so ‚verborgenen' Verbrechen
wie der Zauberei natürlich nicht möglich war oder eines
glaubwürdigen Geständnisses. Ein solches Geständnis
erreichte man auch mit Hilfe der Folter; ihrer Anwendung durch die
Gerichtsorgane waren jedoch Grenzen gesetzt. Obwohl die Carolina zumindest formal
in den meisten deutschen Territorien galt, hat sich diese vergleichsweise
moderate Position in der weiteren Rechtsentwicklung des 16. Jahrhunderts
kaum durchgesetzt. Landesrechte beziehungsweise städtische
Gesetze bildeten das juristische Fundament für die Durchführung
von Hexenprozessen, wobei die jeweilige Prozesspraxis eine "Gemengelage
aus akkusatorischen und inquisitorischen Elementen" aufweisen
konnte, die im Einzelfall zu prüfen ist. Zudem lassen sich
Rückwirkungen der Hexenprozesse auf das Delikt der Hexerei
selbst beobachten. Offenbar haben sich die Verfahren ihren Gegenstand
teilweise erst geschaffen. Generell ist eine Strafverschärfung
durch eine Verlagerung der Strafbarkeit vom Schadenzauber zum Teufelspakt
festzustellen. Die erste Territorialgesetzgebung, die nicht nur
den Schadenzauber, sondern auch den Teufelspakt mit der Todesstrafe
belegte, war die Kursächsische Kriminalordnung von 1572. Die Richter sahen ihre Aufgabe weniger
darin, einzelne, eines Verbrechens für schuldig befundene Personen
ihrer Strafe zuzuführen, als vielmehr in der ‚Reinigung'
ihrer Gemeinschaft von unchristlichen, teuflischen Elementen. Dabei
kam das Verfolgungsbegehren nicht nur von der Obrigkeit, sondern
oft von unten. Die Menschen glaubten an die Existenz von Hexen,
die Krankheiten, Tod und Elend über sie brachten. Gefestigt
wurden sie in diesem Glauben sicherlich auch durch die Predigten
ihrer Pfarrer und Pastoren. Glaube und Profit schlossen mitunter
eine beklemmende Allianz. Hexenprozesse ließen sich leicht
instrumentalisieren und konnten sowohl von Gerichtsherren als auch
von Nachbarn und Verwandten zum eigenen Vorteil genutzt werden.
Die verheerende Dynamik, die in der Logik der Hexenprozesse lag
- die herausgefolterten Namen von vermeintlichen Komplizen führten
meist zwangsläufig zu neuen Verfahren -, wurde wohl zunächst
nur von den wenigsten Zeitgenossen erkannt. Zum Abschluss ist noch einmal kurz auf die Entwicklung der kirchlichen Inquisition zurückzukommen. In den ersten zweieinhalb Jahrhunderten ihres Bestehens war die Inquisition noch keine feste römische Behörde. Bei Bedarf ernannte der Papst bevollmächtigte Inquisitoren. Ein ständiges Tribunal wurde erstmals 1478 auf Initiative der Herrscher von Kastilien und Aragón auf der iberischen Halbinsel eingerichtet. Die Hauptaufgabe dieser halbstaatlichen Institution bestand in der Überwachung der zwangsgetauften jüdischen und muslimischen Bevölkerung Spaniens. Einerseits führte die ‚Spanische Inquisition' diese Konvertiten, denen sie den Rückfall in ihren alten (Un)glauben unterstellte, zu Tausenden auf den Scheiterhaufen, andererseits zeigte sie sich sehr skeptisch gegenüber Hexereibeschuldigungen und trat der Durchführung von Hexenprozessen in Nordspanien sogar entgegen. Mit der Bulle Papst Pauls III. († 1549) Licet
ab initio (1542) wurde ein Kardinalskollegium eingesetzt, das für
die Reinhaltung der Glaubenslehre in der gesamten Christenheit -
mit Ausnahme Spaniens und Portugals - zuständig sein sollte.
Die institutionelle Verankerung als römische Behörde fand
ihren Abschluss mit der Errichtung der Congregatio sanctae Inquisitiones
haereticae pravitatis (Kongregation der Heiligen Inquisition gegen
verstockte Ketzerei) durch Papst Sixtus V. († 1590) im Jahre
1587. Wie schon aus dem Namen hervorgeht, bestand die Aufgabe der
Kardinalinquisitoren in der Bekämpfung der Ketzerei; damit
fiel aber auch die Verfolgung von Zauberei und Hexerei als Sonderfall
der Häresie in ihren Zuständigkeitsbereich. Zwar glaubten
die Kardinäle durchaus an die Realität magischer Verbrechen,
aber insgesamt wurden erstaunlich wenige Hexenprozesse vor der Kardinalsinquisition
geführt. In den mittlerweile der Öffentlichkeit zugänglichen
Quellen der Congregatio lässt sich sogar vielfach ein großes
Maß an Unverständnis der römischen Inquisitoren
für das Ausmaß der Hexenverfolgung nördlich der
Alpen erkennen. Die um das Jahr 1620 entstandene römische Anweisung zur Praxis in Zauberei- und Hexereiverfahren (Instructio pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum et maleficiorum) fasste den Rahmen für solche Prozesse recht eng. So musste ein konkreter Schadensfall - Tod oder Krankheit - vorliegen, um ein Verfahren einzuleiten; eine einfache Denunziation oder Besagung reichte nicht aus. Ein Arzt sollte feststellen, ob es keine natürlichen Ursachen für die Schädigung gab. Erst wenn der Arzt sowie ein zweiter medizinischer Gutachter keine Erklärung fanden, wurde der Prozess eröffnet. Beklagte besaßen die Möglichkeit, die Zeugen schriftlich zu befragen oder Eingaben zu ihrer Verteidigung zu verfassen. Grundsätzlich war der Einsatz der Folter zur Geständniserzwingung erlaubt, diese durfte jedoch nur in der relativ milden Form durch Aufziehen an Seilen erfolgen. Zwar konnte auch die Inquisitionsbehörde als Strafe den Feuertod verhängen, sie war aber offenbar wesentlich stärker an einer Läuterung der von Gott abgefallenen Zauberer und Hexen sowie deren Rückführung in die christliche Gemeinschaft interessiert. Die massenhaften Prozesse während des Höhepunkts der west- und mitteleuropäischen Hexenverfolgungen im Zeitraum zwischen 1560 und 1700 mit ihren hohen Hinrichtungsraten waren jedoch das Werk weltlicher Richter. |
|
|
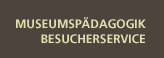 |