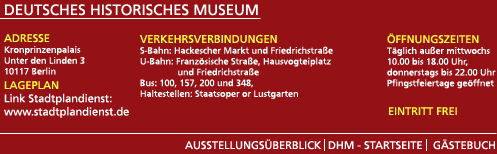|
Es ist ein überaus gerechtes Gesetz,
dass die Zauberinnen getötet werden" Im Morgengrauen eines trüben
Februartages des Jahres 1623 glaubte der Bauernsohn Chim Stolten
im mecklenburgischen Glasewitz (bei Güstrow) seinen Augen kaum
zu trauen. Auf der Feldscheide zwischen dem eigenen und dem benachbarten
Hof reckte sich im trüben Nebeldunst eine graue Gestalt über
den Zaun, hob die Arme und schüttete den Inhalt eines Topfes
auf das Stoltische Anwesen. Spätestens in diesem Moment dürfte
der Mann schlagartig wach gewesen sein. Sofort rannte er aus dem
Haus und rief der flüchtenden Gestalt hinterher. Über
die Bedeutung dieses Vorgangs herrschten weder bei ihm noch bei
den späteren Zeugen dieser Angelegenheit zu irgendeinem Zeitpunkt
Zweifel. Eine Hexe war hier tätig geworden, eine Toewersche,
wie sie im Niederdeutschen nach dem Topf, in dem sie ihre Schadensgifte
braute, benannt wurde. Indem Zauberinnen angeblich solche Güsse
über den nachbarlichen Türschwellen und Wegen ausschütteten
oder sie darunter vergruben, verursachten sie Krankheit und Tod
bei Mensch und Vieh, sobald diese sie überschritten. Dies galt
im gesamten norddeutschen Raum als die übliche Form des Schadenzaubers,
die zwischen 1550 und 1700 wohl jedes Kind kannte und fürchtete.
Im Bund mit dem Teufel trieben vermeintliche Hexen darüber
hinaus ihr Unwesen, indem sie mithilfe des Milchzaubers die Nachbarn
um das kostbare Produkt der Kühe brachten, das Bier verdarben,
den Teufel zum Diebstahl von Geld und Korn animierten oder - seltener
- das zwischenmenschliche Miteinander störten. Der im Süden
des Reiches dagegen so umfassend gefürchtete Unwetterzauber
der Hexen, der sich vor allem gegen die empfindlichen Weinkulturen
richtete, blieb in den Getreideanbaugebieten des Nordens nahezu
unbekannt. Als Mann der Tat zögerte Chim
Stolte nicht lange, sondern rief einige der Dorfbewohner zusammen,
um die im aufgetauten Erdreich gut erkennbaren Fußspuren zu
verfolgen. Die Richtung, in die diese Fußspuren führten,
war weder für Stolte noch für die hilfsbereiten Nachbarn
verwunderlich. Sie wies geradewegs zum Hof der benachbarten Familie
Sandmann. Alle Frauen des Haushaltes mussten ihre Füße
und Schuhe vorzeigen und mit dem Abdruck vergleichen lassen. Eigentlich
hätte es dieser Kontrolle jedoch gar nicht bedurft. Im Haus
der Familie Sandmann wohnte die schon seit Jahren als Hexe berüchtigte
und mehrfach von den Dorfbewohnern verklagte Altenteilerin Anna
Polchow. Wohl kaum jemand im Dorf zweifelte daran, dass sie die
Gestalt im Morgengrauen gewesen war. Statt dessen hoffte man wohl,
endlich mit einem stichhaltigen Indiz über die Hexe triumphieren
zu können. Denn bisher waren alle Bemühungen zur Beseitigung
der Frau gescheitert, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester
an nicht weniger als dem Tod zweier Menschen, der Erkrankung zweier
weiterer Personen sowie der Verendung von 42 Pferden, zwei Fohlen,
einem Ochsen, sieben Schweinen, einer Kuh, vier Kälbern und
"etlichem anderen Kleinvieh" die Schuld tragen sollte.
Angesichts dieses unermesslichen Unglücks lässt sich der
Zorn und das Entsetzen der betroffenen Nachbarn darüber nachempfinden,
dass seit 1615 bereits zwei Prozesse gegen die ‚Unholdinnen'
einfach abgewiesen worden waren. Die Juristenfakultät Rostock,
die, wie andere Juristenfakultäten, nach Maßgabe der
Carolina in Kriminalverfahren ihre Rechtssprüche erteilte,
hatte auch im Glasewitzer Fall ihr Votum ausgesprochen. Dementsprechend
war Anna Polchows Mutter zwar mit der Folter im ersten Grad bedroht
worden, eine belastende Aussage hatte ihr das städtische Gericht
jedoch nicht abringen können. Daraufhin ordneten die Juristen
ihre Entlassung an. Auf ein peinliches Verhör der beiden Töchter
wurde völlig verzichtet. Im zweiten Prozess gegen die drei
Frauen wurden die Indizien von vornherein verworfen und die Fortsetzung
des Prozesses verboten. Sehr ähnlich urteilten bis zum
Dreißigjährigen Krieg weitgehend auch die Juristen in
den mecklenburgischen Justizkanzleien in Güstrow beziehungsweise
in Schwerin und mit einigen deutlichen Abstrichen auch an der pommerschen
Universität Greifswald. Über allen strahlte jedoch die
juristische Fakultät der in den Jahrzehnten um 1600 zu vollem
Glanz erblühten Universität Rostock. Nicht nur in mecklenburgischen
Hexenprozessen, sondern auch für Konsulenten der benachbarten
Territorien - Schleswig, Holstein, Sachsen-Lauenburg, Brandenburg,
Pommern und weit darüber hinaus - formulierten die hervorragenden
Juristen Rechtsgutachten. In Rostock teilte man die Theorie über
die Verschwörung der Hexen in Form einer Sekte, über Teufelsbuhlschaft
und orgiastischen Sabbat nicht in der Weise, wie sie etwa im Hexenhammer
und anderer dämonologischer Literatur entwickelt worden war.
Grundlegend dafür war einerseits das protestantische Verständnis
von Hexerei sowie andererseits das Beharren auf den regulären
Vorgaben des zeitgenössischen Kriminalprozesses (Carolina).
In der Praxis bedeutete dies eine Ablehnung des in Hexenprozessen
oft angewandten Ausnahmeverfahrens (crimen exceptum). Nach dessen
Maßgabe wurde meist die schnelle Anwendung der Folter auf
der Grundlage von Bezichtigungen bereits verurteilter Personen (Besagung)
und ohne vorherige Verteidigung gestattet. Dabei waren protestantische Geistliche
und Juristen keineswegs die besseren Christen, wie es die protestantischen
Vertreter des Kulturkampfes im späten 19. Jahrhundert teilweise
darzustellen versuchten. Die strikte Ablehnung der Hexenverfolgung
lag ihnen - abgesehen von wenigen Ausnahmen auf beiden Seiten -
ebenso fern wie den Glaubensgegnern. Der geistige Vater der neuen
Konfession, Martin Luther († 1546), hatte im Einklang mit den
katholischen Stimmen geurteilt: ... weil Zäuberei ein schändlicher,
gräulicher Abfall ist, da sich einer von Gott, dem er gelobt
und geschworen ist, zum Teufel, der Gottes Feind ist, begibt, so
wird sie billig an Leib und Leben gestraft. Diese Worte einer Tischrede
kennzeichnen deutlich die energische Forderung Luthers nach der
Bestrafung von Zauberei und Hexerei. Beides kam für Luther
dem willentlichen Bruch des Taufgelübdes, dem abscheulichen
Verrat an Gott gleich und stellte für ihn eine Tat von höchster
Strafwürdigkeit dar, die nur durch den Tod gesühnt werden
konnte. In der Konsequenz forderte er damit die gleiche Strafe wie
die eifrigsten Protagonisten der Hexenverfolgung. Allerdings verbargen
sich dahinter gänzlich andere Vorstellungen, die ihn zur Forderung
nach der Ausrottung von Hexerei geführt hatten. Zwar glaubte
Martin Luther wie alle seine Zeitgenossen fest an die Möglichkeit
und Wirksamkeit von Schadenzaubertaten, den Glauben an eine teuflische
Sekte von Hexen und Hexern teilte er jedoch nicht in derselben Weise.
Für Luther gab es die gleichberechtigte oder gar übermächtige
dämonische Gegenwelt des Satans nicht. Hexen konnten nur im
Rahmen des göttlichen Willens agieren. Daher spielten die Teufelsbuhlschaft,
der Hexensabbat und die Bildung einer Hexensekte bei dem Wittenberger
Theologen nur eine untergeordnete Rolle. Die Strafwürdigkeit
ergab sich allein aus dem Willen der Hexen, sich dem Bösen
dienstbar zu unterwerfen. Luther forderte daher ein Ende von
Magie, Zauberwerk und Aberglauben. Konsequent bereinigte er nicht
nur die protestantische Liturgie von allen Formen anrüchiger
Praktiken. In gleicher Weise wurden auf breiter Basis sämtliche
volksmagischen Praktiken kriminalisiert und den Predigern eine strenge
Aufsicht über die Gemeinden empfohlen. Luther, der selbst den
Beginn der großen Hexenjagd nicht mehr erlebte, hinterließ
kein geschlossenes Gedankensystem, sondern nur bruchstückhafte,
sich teilweise sogar widersprechende Äußerungen zum Problem
der Hexenverfolgung. Es verblieb seinen Nachfolgern, die ‚protestantische'
Theorie des Hexenglaubens zu formulieren und den realpolitischen
Umständen in jedem einzelnen Territorium anzupassen. Im Norden des Deutschen Reiches führte
diese protestantische Deutung zunächst zu einem eher gemäßigten
Umgang mit der Hexenangst. Protestantische Gelehrte - wie etwa der
Rostocker Jurist Johann Georg Goedelmann († 1611) in seinem
schon bald übersetzten Traktat Von Zäuberern, Hexen und
Unholden (Tractatus de magis, veneficis et lamiis, 1584) - verwarfen
nicht den Hexenglauben an sich. Sie erschwerten jedoch die Zulassung
der Tortur, indem sie hohe Anforderungen an die Stichhaltigkeit
und Glaubwürdigkeit der belastenden Indizien und Zeugenaussagen
stellten. Da sie die Vorwürfe der Teufelsbuhlschaft, des Hexenfluges,
der Tierverwandlung und der Sabbatfeiern teilweise in das Reich
der Phantasie der Angeklagten verlegten, sahen sie keine Notwendigkeit
gegeben, die Hexen in einem außerordentlichen Gerichtsverfahren
abzuurteilen. Im Norden blieben den angeklagten Menschen daher Folterungen
erspart, wenn sie lediglich von anderen Hexen als Komplizen des
Verbrechens besagt worden waren. Gleichfalls blieben die Möglichkeiten
zur Einsicht in die Akten und zur gerichtlichen Verteidigung erhalten.
Brachte die protestantische Religion
mit ihrer Säkularisierung des Glaubens also eine Rationalität
mit sich, welche die schlimmsten Auswüchse der Hexenjagd verhindern
konnte? Bis heute hält sich hartnäckig die Annahme, die
Hexenverfolgung in den protestantischen Territorien sei wesentlich
maßvoller abgelaufen als in katholischen Gebieten, die oft
zu den Kernzonen der Verfolgung gehörten. Die Forschung in
den klassischen protestantischen Regionen im Norden und Osten des
Deutschen Reiches verfügt bis heute über mehr Fragen als
Antworten. Nur in Ansätzen lässt sich deshalb bisher sagen,
welche Rolle die Religionszugehörigkeit im Kontext der Hexenverfolgungen
spielte. Für Territorien, in denen mittlerweile umfangreichere
Untersuchungen vorliegen, sprechen die Prozesszahlen eindeutig dafür,
dass der protestantische Norden eben nicht von einer Hexenverfolgung
in größerem Umfang verschont geblieben ist. Bedrückend wirken allen voran
die Prozesszahlen im bevölkerungsarmen Mecklenburg. Bei annähernd
200.000 Einwohnern wurden, zwischen 1560 und 1700, nachweislich
fast 4.000 Hexenprozesse geführt. Mindestens 2.000 Menschen
fanden hier den Tod. Nicht umsonst war Mecklenburg schon bei den
Zeitgenossen aufgrund der beängstigenden Auswüchse der
Verfolgung verschrien. Weitab von den Kernzonen der Verfolgung im
Südwesten des Reiches entwickelte sich in Mecklenburg isoliert
eine Verfolgungsintensität, die sich deutlich von der Verfolgung
in den benachbarten Territorien abhob. Mit solchen Opferzahlen gehörte
Mecklenburg ganz sicher zu den Zentren der europäischen Hexenjagd.
Einen frühen Höhepunkt
erlebte die Verfolgung um 1600. Das verheerende Pestjahr 1604 forderte
die meisten Opfer; mindestens 111 Anklagen wurden in diesem Jahr
erhoben. Danach ebbte die Hexenjagd allmählich wieder ab und
wurde während der Schreckensjahre des Dreißigjährigen
Krieges fast bedeutungslos. Im Gegensatz dazu wuchs die Furcht vor
den Anschlägen der Teufelsbündnerinnen nach dem Krieg
ins Unermessliche. Die Verfolgung schien tatsächlich die Form
eines ‚Hexenwahns' anzunehmen, der zur Verfolgung jeder noch
so unglaubwürdigen oder nichtigen Bezichtigung beziehungsweise
Denunziation führte. Das Klima der Angst schlug sich nicht
nur in einem erneuten Anstieg der Anklageforderungen nieder, sondern
gleichzeitig wurden auch die rechtlichen Maßstäbe und
landesherrlichen Intentionen deutlich zuungunsten der Angeklagten
verschoben. Landesherrliche Machtträger entwickelten in beiden
Landesteilen Handlungsstrategien, die eine wirksame Ausrottung der
Hexerei bewirken sollten. Die verstärkten Repressionen gegen
die Hexen begünstigten eine Eskalation der Hexenangst und schlugen
sich zunehmend in Gestalt von umfangreichen Prozess-Serien nieder.
Die Aussagen bereits verurteilter Hexen wurden zum Anlass immer
neuer Untersuchungen und weiterer Prozesse. Nur bei erbittertem
Widerstand der Betroffenen und ihrer Angehörigen konnte der
unheilvolle Teufelskreis gestoppt werden. Auch Schleswig, Holstein und Sachsen-Lauenburg
zählten nach den neuesten Untersuchungen von Rolf Schulte nicht
zu den prozessarmen Territorien. Obwohl die dänische Gesetzgebung
(Jyske Lov), die im Herzogtum Schleswig Geltung besaß, keine
Bestimmungen zur tödlichen Ahndung von Hexerei und Zauberei
vorsah, kam es auch dort zu legalen Hexenverbrennungen. Für
die beiden Landesteile Schleswig und Holstein konnten im Zeitraum
zwischen 1530 bis 1735 etwa gleich viele Hexenprozesse ausgemacht
werden - insgesamt mindestens 846. Ähnlich wie in Mecklenburg
wurde von Seiten der Landesherrschaft besonders in den frühen
Jahren der Hexenverfolgung auf eine Eindämmung der schlimmsten
Auswüchse hingearbeitet. Allerdings blieben die Erfolge solcher
Versuche von bescheidener, temporärer Wirkung. Schon zwischen
1610 und 1630 mussten zahlreiche Menschen den Scheiterhaufen besteigen.
Zeitgleich dazu etablierte sich in Holstein, Schleswig und Sachsen-Lauenburg
eine verschärfte landesherrliche Gesetzgebung, um das Hexenwerk
wirksam auszurotten. Ungefähr 70 Prozent der Angeklagten mussten
insgesamt den Scheiterhaufen besteigen, obwohl auch hier die Regelungen
des ordentlichen Gerichtsverfahrens in Anlehnung an die Carolina
weitgehend bestehen blieben. Nach wie vor unbefriedigend bleibt
der Blick ins weiter südlich gelegene ostelbische Territorium.
Für Sachsen-Anhalt, wo große Quellenverluste zu beklagen
sind, lassen sich bisher nur annähernd 200 Prozesse nachweisen.
Nachrichten von schwindelerregenden Massenhinrichtungen - wie etwa
der Verbrennung von 133 Hexen in Quedlinburg im Jahre 1589 - erwiesen
sich als falsch. In Quedlinburg selbst sind während der gesamten
Hexenverfolgung nur 40 Opfer nachweisbar. Gegenwärtig kann
ebenso wenig über die Hexenverfolgung in Brandenburg ausgesagt
werden. Neuere Untersuchungen zeigen zwar auf, dass es auch hier
partiell zu Verfolgungswellen kam; der größere Überblick
bleibt jedoch versagt. Lediglich für Thüringen liegen
mit einer bisher noch unveröffentlichten Arbeit neuere Zahlen
zur Hexenverfolgung vor. Nach Untersuchungen von Ronald Füssel
fanden dort zwischen 1.000 und 1.500 Prozesse statt. Wie im Glasewitzer Fall wurde die
Hexenverfolgung ursprünglich nicht von gelehrten Juristen,
Theologen oder den Landesobrigkeiten, sondern von den Nachbarn der
Verdächtigen vorangetrieben; denn Hexereibezichtigungen ergaben
sich im Kontext nachbarlicher Streitigkeiten. Die Hofstelle des
Ehepaars Claus Sandmann und Anna Polchow war kurz zuvor geteilt
und die Hälfte an den jüngeren Bruder Heinrich Sandmann
und seine Ehefrau vergeben worden. Neben den bereits zuvor virulenten
wirtschaftlichen Streitigkeiten traten zwischen den beiden Frauen
des Haushalts schon bald Konflikte offen zu Tage. Anna Polchow konnte
sich durchaus nicht mit ihrer neuen, untergeordneten Rolle im Haushalt
abfinden. Häufig versuchte sie nach wie vor zu reglementieren
und in Wirtschaftsabläufe einzugreifen. Allerdings nahmen Knechte
und Mägde ihre Rolle nicht mehr ernst, reagierten mit Spott
oder gar mit Gewalt. Die alte Frau griff in solchen Situationen
zur letzten Waffe, die ihr geblieben war - zur Drohung. Das solle
ihm Gott gedenken oder sie solle verdorren wie ein Stock am Zaune
lauteten etwa ihre heftigen Reaktionen. Trat kurze Zeit darauf tatsächlich
ein Schadensfall ein, wurde fast zwangsläufig Hexerei vermutet.
Ausschlaggebend für diese Unterstellung war der ihr bereits
seit Jahren anhängende schlechte Ruf. Wie bei fast 30 Prozent
aller Angeklagten im Norden waren Familienangehörige Anna Polchows
bereits früher wegen Hexerei verdächtigt oder angeklagt
worden. Ihre Mutter Ilse Vielhut war zuvor durch Segenssprüche
- in Norddeutschland Böten genannt - und die Ausübung
einfacher volksmagischer Heilpraktiken auffällig geworden.
Außerdem war sie vor Jahren von einer Hexe besagt worden,
ebenfalls der Hexensekte anzugehören. Solche Besagungen, besonders
wenn sie von Hexen kurz vor ihrer Verurteilung geäußert
wurden, waren ebenfalls in einer Vielzahl von Fällen Auslöser
für eine Verdächtigung im Lebensumfeld. Unter diesen Umständen
wurde gemutmaßt, die Mutter hätte die Zauberkunst an
die Tochter weitergegeben, was der volkstümlichen Deutung des
Sektengedankens entsprach. Nachdem der Verdacht gegen die Frau
im Dorf laut geworden war, fanden sich immer mehr Nachbarn, die
ihr Verhalten überkritisch reflektierten und Streitigkeiten,
schließlich selbst Banalitäten, als Anlässe für
zauberische Schadensattacken interpretierten. In den Dörfern
entzündeten sich solche Konflikte mehrheitlich an der Schädigungen
des Besitzes. Die Vernichtung von Saat- und Erntegut, Grenz- und
Ackerstreitigkeiten oder ausstehender Lohn beziehungsweise Schulden
waren Anlässe für Hexereivorwürfe. Streitigkeiten
ergaben sich ebenfalls im Umgang mit den Kindern der Hexen, die
als Knechte und Mägde bei den Nachbarn tätig waren, beziehungsweise
aus Gewaltanwendungen gegen die Hexen und ihre Angehörigen.
Familienkonflikte wie Ehe-, Erbschafts- und Generationskonflikte
bildeten dagegen nur höchst selten den Anstoß zu Hexereiverdächtigungen.
Dies lag schon deshalb nahe, weil Hexereiprozesse in der Familie
letztlich auf die gesamte Verwandtschaft zurückfallen konnten. Auf welchen Konflikten die Hexereizumessung basierte, konnte in den unterschiedlichen Lebenswelten - also den größeren und kleineren Städten, adligen oder landesherrlichen Dörfern - ganz verschieden sein. In dieser Hinsicht blieb der Hexenprozess immer Spiegelbild der alltäglichen Verhältnisse unter bestimmten, spezifischen Lebensbedingungen. Weil die Hexereibeschuldigungen so flexibel auf immer neue Situationen ausgeweitet werden konnten, wurden sie attraktiv für die Lösung verschiedenster zwischenmenschlicher Konfliktlagen. Diese Flexibilität schuf immer neuen Nährboden für Hexereiverdächtigungen, die sich aus diesem Grund schnell großer Popularität erfreuten. Indem man die Schuld für einen Unglücksfall den Hexen zuschreiben konnte, brauchte man sie nicht als göttliche Rache für eigenes Fehlverhalten interpretieren. Zunächst waren es häufig noch eher arme,
alte, alleinstehende Frauen und Männer, die in das Visier der
Verfolgung gerieten. Deutlich zeigt sich dieses Muster in den frühen
Prozessen der großen Städte. In den bedeutenden Hansestädten
wie Hamburg, Lübeck, Wismar, Rostock und Stralsund wurden gerade
die Ärmsten hingerichtet, die sich tatsächlich mit magischen
Praktiken ihren Lebensunterhalt verdienten. Häufig handelte
es sich um landfahrende oder sesshafte Bettlerinnen, die ein breites
Repertoire von Künsten des Wahrsagens und Heilens, des Liebeszaubers,
Schatzgrabens und kleinerer Betrügereien beherrschten. Zudem
gerieten in den Städten Personen in die Fänge der Justiz,
weil sie tatsächlich kriminell waren und wegen Diebstahls,
Mordes, aggressiver Bettelpraktiken oder anderer Straftaten auffielen.
Die Verfolgung in den größten Städten war nicht
so sehr von den Vorstellungen des Teufelspaktes und der Hexensekte
geprägt, sondern orientierte sich weit mehr an den relativ
konkreten Indizien des Zaubereiverdachts beziehungsweise eines generell
auffälligen, unsozialen Lebenswandels. Die tatsächliche
Ausübung einfacher volksmagischer Praktiken und deren betrügerische
Nutzung sowie ein eklatant abweichendes Verhalten konnte auf diese
Weise schnell in einen Hexenprozess münden. Dennoch konnte die Bürgerschaft solche Forderungen
nur selten gegen den Widerstand der Stadträte durchsetzen.
In der Folter erpresste Beschuldigungen gegen andere vermeintliche
Hexen versuchte man in den großen Städten weitgehend
geheim zu halten, um eine hysterische Steigerung von Anschuldigungen
zu verhindern. Als in Rostock nach einem Prozess gegen drei junge
Männer das Gerücht aufkam, Söhne der Bürgermeister
wären an den Zaubertaten beteiligt gewesen, ließ man
kurzerhand die Diffamantin aus der Stadt weisen. Durchweg straften
die größeren Städte ihre Delinquenten zudem sehr
viel milder ab, als dies im umliegenden Territorium der Fall war.
Beispielsweise entkamen über zwei Drittel der in Lübeck
angeklagten Personen lebend einem Prozess. Relativ häufig wurde
die Stadtverweisung angeordnet, ohne die Angeklagten zuvor gefoltert
und so die Ausweitung des Prozesses riskiert zu haben. Nicht nur in den größeren Städten
wurde eine solche Ratsjustiz mit dem geflügelten Wort die armen
in die asche, den Reichen in die tasche kritisiert. In den zahlreichen
kleinen und kleinsten Landstädten und Flecken konnte sich die
erregte, nach Verfolgung drängende Bürgerschaft sehr viel
besser mit solchen Forderungen durchsetzen. In den meisten Landstädten
kam es schnell zu einer Ausweitung der Hexenverfolgung auf alle
sozialen Schichten der Gesellschaft. Dort machte die Hexenverfolgung
vor niemandem Halt. Das Spektrum der Angeklagten reichte schon bald
vom dreijährigen Kind bis zur hundertjährigen Greisin,
vom Bettelweib bis hin zum Bürgermeister oder der adligen Stadtbewohnerin.
Vor allem dort entfaltete sich die Hexenverfolgung in Gestalt einiger
großer Kettenprozesse. Soziale Konflikte waren in solchen
Prozessen schon bald nicht mehr Auslöser für die Anklageerhebung.
Stattdessen wurden die Geständnisse der Hexen über die
Komplizen an Sabbatfeiern und Schadenzaubertaten kritiklos zur Einleitung
immer neuer Prozesse genutzt. Anders als in den größeren
Städten schafften es die Stadträte nicht, die breite Bürgerschaft
und konkurrierende Herrschaftsträger (etwa landesherrliche
Beamte) von der Prozessführung auszuschließen. Oft fiel
es ausschließlich den Angehörigen und Freunden der Angeklagten
zu, Widerstand gegen die Hexenverfolgung zu leisten. Da in den Kleinstädten
besonders viele Angehörige der reicheren Mittel- und Oberschichten
angeklagt wurden, gab es hier zugleich die meisten Versuche, Angeklagte
mit gerichtlichen Mitteln zu unterstützen. Gerade in diesen
Familien distanzierte man sich nicht so schnell von den Beschuldigten,
sondern hielt - teils aus tiefen emotionalen Gründen, teils
aus sozialem und wirtschaftlichem Kalkül - an der Unschuld
der Angeklagten fest. Etwa in jedem vierten kleinstädtischen
Verfahren legten die Angehörigen Supplikationen bei der Landesherrschaft
ein oder engagierten professionelle Anwälte zur Verteidigung.
Zahlreiche Familien zogen vor die Appellationsinstanzen oder vor
das Reichskammergericht, um ihr Recht einzufordern. In Mecklenburg
lassen sich fast 150 solcher Verfahren nachweisen. Die Gesamtheit
aller Bemühungen verbesserte die Chancen der Angeklagten auf
eine Freilassung erheblich. In fast 60 Prozent der Fälle, in
denen nur der geringste Versuch einer Verteidigung unternommen wurde,
konnte man letztlich die Entlassung der Angeklagten durchsetzen.
Wurde eine Verteidigung unterlassen, lag der Prozentsatz von Freilassungen
und von Todesurteilen im umgekehrten Verhältnis zueinander. Mit dem Widerstand der Betroffenen und ihrer Angehörigen
verschärfte sich gleichzeitig die Auseinandersetzung zwischen
den Streitparteien beziehungsweise zwischen Gericht und Angeklagten.
Da die Beschuldigten die Unterstützung der Landesherrschaft
durch Beschwerden über die Parteilichkeit und Rechtswidrigkeit
der Gerichte einklagten, mussten diese bei einem entsprechenden
Nachweis Rügen und Bestrafungen befürchten. Zugleich nutzten
die Landesherren solche Möglichkeiten gern, um ihren Einfluss
auf die innerstädtische Gerichtsbarkeit auszuweiten und sie
enger in das Netz des landesherrlichen Verwaltungsapparates einzubinden.
In einigen Kleinstädten kam es - wie etwa 1694
im mecklenburgischen Wittenburg - aufgrund solcher Umstände
zu fast tumultartigen Zuständen. Der Amtsschreiber Georg Havemann
beschrieb die Verhältnisse in der Stadt als Ausnahmezustand:
Die Stadttore waren geschlossen worden. Einige Bürger hatten
sich in der Stadt verbarrikadiert und mit Büchsen bewaffnet.
Innerhalb der Bürgerschaft brodelte eine heftige Auseinandersetzung
zwischen den Akteuren der Anklage und denen der Verteidigung, die
längst nicht mehr nur mit prozessualen Mitteln ausgetragen
wurde. Die Stadträte bemühten sich, durch weitere Prozesse
belastende Indizien zu ‚produzieren', indem die ursprünglichen,
jedoch nicht überführten Angeklagten von immer neuen Hexen
besagt wurden. Das Wach- und Gerichtspersonal steuerte zu diesem
Zweck haarsträubende Berichte über die im Gefängnis
auftretenden Geister der Inhaftierten bei. Vertreter der Bürgerschaft
hingegen, die nun ebenfalls in die Anklagen verstrickt wurden, weigerten
sich, ein solches Vorgehen länger zu tolerieren und riefen
zum Widerstand auf. Diese Ereignisse führten dazu, dass weite
Teile der Bürgerschaft nicht nur das Interesse an der Hexenverfolgung
verloren, sondern einige Bürger offen dagegen auftraten. Die
Hexenverfolgung hatte längst ihren Charakter als Ventil sozialer
Konflikte verloren und war stattdessen selbst zum Streitpotential
angewachsen. Der Zerfall der zuvor geschlossenen Verfolgungsallianz
führte schließlich zur Beendigung der Prozesswelle. Ähnlich verlief die Entwicklung in vielen anderen
Kleinstädten. Gemessen am Umfang der kleinstädtischen
Einwohnerzahlen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung tobte
die Hexenverfolgung gerade in den kleinen Ackerbürgersiedlungen
des gesamten Nordens am heftigsten. In den norddeutschen Dörfern hingegen unter adliger
Jurisdiktion zeichnet sich ein wesentlich anderes Bild ab. Mecklenburg
und Pommern sind in die Geschichte als Synonyme für die Entwicklung
von Gutsherrschaftsgesellschaften eingegangen. Bemerkenswerter Weise
verliefen beide Entwicklungsprozesse zeitlich parallel. Die Konsolidierungsphase
adliger Gutsherrschaften entfaltete sich in Mecklenburg, Vorpommern
und Holstein während des ersten Höhepunkts der Hexenverfolgung.
Die Abhängigkeit der Bauern erwuchs letztlich aus der Nutzung
von Rechtskompetenzen der Adligen. Den Gerichtsrechten kam somit
eine wichtige Funktion bei der Etablierung der Leibeigenschaft zu.
Tatsächlich lässt sich in diesem Stadium eine auffällige
Häufung von Hexenprozessen unter adligen Gerichten konstatieren.
Fast 40 Prozent aller Hexenprozesse in Mecklenburg wurden vor 1640
unter adliger Jurisdiktion geführt. Wie in den landesherrlichen Dörfern wurde der
Schadenzaubervorwurf nach Konflikten zwischen den Streitparteien
zum eigentlichen Anlass der Hexereibezichtigung. Bildeten unter
den landesherrlichen Gerichten jedoch sozial gleichberechtigte Nachbarn
die Streitparteien, so waren es unter den adligen Gerichten überdurchschnittlich
häufig - nämlich in fast 60 Prozent aller Prozesse - Herr
und Untertan, die sich im Gericht gegenüberstanden. Dabei drehten
sich die Konflikte vor allem um die alltäglichen Auseinandersetzungen,
um Arbeitsleistungen und -dienste, finanzielle Belastungen und Gewaltanwendungen.
Die Durchsetzung der gutsherrlichen Forderungen nahmen die Betroffenen
in der alltäglichen Praxis durchaus nicht widerstandslos hin.
In den Hexenprozessen spiegeln sich solche Auseinandersetzungen
lebhaft wider. Diese Konflikte verführten adlige Gerichtsherren
dazu, hinter wirtschaftlichen Misserfolgen und Krankheiten Hexerei
zu mutmaßen. Diese Konstellation war höchst gefährlich
für die Angeklagten, da die Ankläger nun zugleich die
Gerichtsherren waren. So kam es ebenso wie unter den kleinstädtischen
Gerichten häufig zu Vorverurteilungen. Adlige Junker setzten
sich über den landesherrlichen Willen nach Mäßigung
hinweg und proklamierten eigenwillig ihre eigenen Auffassungen von
Recht und Ordnung. Im gesamten norddeutschen Raum wurde unter den
adligen Gerichten die härteste Urteilspraxis ausgeübt.
Je nach landesherrlicher Durchsetzungskraft gelang es den Regenten
nur mühevoll, solche Auswüchse adliger Macht zu beschneiden. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts veränderten
sich die Vorzeichen adliger Gerichtsausübung allerdings erheblich.
Ausgedehnte, kostenintensive Gerichtshandlungen empfanden viele
Adlige zunehmend als störend für den reibungslosen Ablauf
der gutsherrlichen Wirtschaft. Man bemühte sich, Streitigkeiten
zwischen den Untertanen gütlich zu schlichten oder wies die
vermeintlichen Straftäterinnen auch ohne Gerichtsprozess einfach
aus dem Rechtsbezirk aus. Zunehmend gerieten adlige Gerichtsherren
damit in Widerspruch zum Willen der Landesherrschaft. Nach dem Dreißigjährigen
Krieg hatte sich in Mecklenburg eine massive Hexenangst ausgebreitet,
die zur Verschärfung des Rechtsprozesses und zu einer landesherrlich
forcierten Ausrottungskampagne der Hexerei führte. Genau den lebensweltlichen Besonderheiten und sozialen
Rahmenbedingungen entsprachen die Zielgruppen, die der Hexenverfolgung
zum Opfer fielen. Waren es in den größten Städten
eher unterprivilegierte Witwen, Bettlerinnen und Vaganten, so kamen
die Angeklagten in den Kleinstädten eher aus den Schichten
der wohlsituierten Bürgerschaft. Während in Schleswig-Holstein
(bei schmaler Vergleichsbasis) eher die arme, alte alleinstehende
Frau zum Opfer der Verfolgung wurde, entstammten die Angeklagten
in Mecklenburg und Vorpommern der Mitte der Gesellschaft. Überwiegend
waren die Opfer Angehörige der Unter- und Mittelschichten und
entsprachen in ihrer sozialen Herkunft wohl dem Durchschnitt der
Bevölkerung. In beiden Territorien waren fast 80 Prozent der
Angeklagten verheiratet. Witwen waren nur in etwa zehn Prozent der
Verfahren betroffen. Eine gehäufte Anklage von Witwen blieb
immer eine Sonderentwicklung der größeren Städte,
in denen ohnehin relativ viele verwitwete Frauen lebten. Die restlichen
Anklagen entfielen auf Kinderhexenprozesse, die - wie im gesamten
Reich - zu einem besonderen Phänomen der Spätphase der
Hexenverfolgung wurden. Hexerei wurde, wie andere Kriminalstraftaten auch,
geschlechtsspezifisch wahrgenommen. In dieser Hinsicht unterschieden
sich die norddeutschen Territorien nur graduell. Über 85 Prozent
der Angeklagten waren Frauen (Mecklenburg 85, Schleswig-Holstein
88,1, Vorpommern 88,7 Prozent). Die lange Tradition latenter Frauenfeindlichkeit
- besonders unter geisteswissenschaftlichen Gelehrten - und die
geschlechtsspezifische Zumessung von schädigenden Zauberpraktiken
fanden in Norddeutschland ihr Echo. Die Reformation brachte zwar
einerseits durch die Aufwertung der Rolle der Ehefrau eine größere
Anerkennung des weiblichen Geschlechts, beschränkte aber andererseits
den weiblichen Wirkungsradius auf den Haushalt und unterstellte
ihn der hausväterlichen Autorität. Generell kann für
die protestantischen Territorien eine Fokussierung der Verfolgung
auf Frauen ausgemacht werden. Wurden Männer in Hexenprozessen
angeklagt, so zeichneten sie sich oft durch einen besonders auffälligen
Charakter aus oder waren tatsächlich kriminell vorbelastet.
Eine größere Gruppe von Männern geriet im Kontext
mit Anklagen anderer Familienangehöriger in das Visier der
Justiz. Zudem waren es überwiegend Knaben und männliche
Jugendliche, die in den Kinderhexenprozessen angeklagt wurden. Gerade dieses Phänomen darf wohl als ein deutliches
Zeichen für die zunehmende Dysfunktionalität der Hexenjagd
gewertet werden, wie sie in der Spätphase der Verfolgung offensichtlich
wurde. In ähnlicher Weise lassen sich die größeren
Kettenprozesse in der Haupt- und Spätphase der Hexenverfolgung
einschätzen. Die Verfolgung lief nicht langsam aus, ihrer Beendigung
gingen oft massive Prozesswellen voraus. Einzelnen Persönlichkeiten, die sich aufgrund
religiöser, rechtlicher und individueller Motive als Hexenjäger
berufen fühlten, kam eine entscheidende Rolle bei der Entstehung
solcher Verfolgungsspitzen zu. Allein im Jahr 1626 ließ der
im holsteinischen Fehmarn tätige ‚Hexenkommissar' Berend
24 Menschen vor Gericht stellen. Nur wenige Jahre später folgten
nochmals mehr als ein Dutzend Anklagen. Im pommerschen Klempenow
füllte diese Rolle der Amthauptmann Alexander von Walsleben
aus. Er leitete zwischen 1619 und 1623 mindestens 31 Anklagen ein,
die häufig mit dem Tod der Unglücklichen endeten. Über alle Landes- und Jurisdiktionsgrenzen hinweg
kam es bei einem besonderen Engagement Einzelner zu Massenverfolgungen.
Frühe Versuche in beiden Territorien, die Hexenverfolgung einzudämmen
oder gar ganz zu unterbinden, ließen sich in der alltäglichen
Gerichtspraxis offensichtlich nicht durchsetzen. Obwohl beispielsweise
die schwedische Königin Christina († 1689) bereits 1649
verfügte, dass alle fernere Inquisition und Prozess in diesem
Hexen Wesen eingestellt werden sollte, fand die pommersche Verfolgung
dennoch ihre Fortsetzung. Schnell in Vergessenheit geriet auch die
Verfügung des Dänenkönigs Friedrich II. († 1588)
von 1576, alle Todesurteile in Hexenverfahren durch das königliche
Obergericht überprüfen zu lassen. Sehr ähnlich gestalteten sich die Verhältnisse
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Mecklenburg-Schwerin.
Dort etablierte sich an der Landesspitze ein Rechtsgremium, das
die erbarmungslose Verfolgung von Hexerei zur Leitlinie seines Handelns
erhoben hatte. Der in Frankreich weilende Herzog Christian Louis
I. († 1692) konnte sich - trotz der persönlichen Ablehnung
von Todesurteilen in Hexenprozessen - 1669 nicht gegen diese Verfolgungsallianz
durchsetzen. Eine wirksame Kontrolle der Gerichte entfiel in dieser
Phase mecklenburgischer Rechtsprechung völlig. In vielen Orten
Mecklenburg-Schwerins kam es daher zu heftigen Verfolgungswellen. Unter der Fahne der protestantischen Konfessionalisierung
führte auch die Landesherrschaft in Mecklenburg-Güstrow
den Kampf gegen jede Form magischen Volksglaubens. Ins Visier der
Hexenjagd gerieten die vermeintlichen Hexen ebenso wie Wunderheiler,
Schatzgräber, Wahrsager und Zukunftsdeuter. Anders als in katholischen
Territorien, für die nachgewiesen werden konnte, dass gerade
die Berufsgruppen, die traditionell mit volksmagischen Heilpraktiken
zu tun hatten, der Verfolgung entgingen, kannte man im protestantischen
Mecklenburg-Güstrow keinerlei Schonung. In Güstrow wurden
weitreichende Untersuchungen unter den berüchtigten Berufsgruppen
der Quacksalber und Bader, Schmiede, Scharfrichter, Hebammen und
Schäfer durchgeführt. Der zutiefst religiöse Herzog
Gustav Adolf († 1695) ließ magisch verdächtige Bäume
(zum Beispiel so genannte Krupeichen) fällen und an den herzoglichen
Hof schaffen, um ihre Vernichtung sicher zu stellen. Alle Pastoren
wurden zur regelmäßigen Abfassung von Berichten über
Aberglauben und Magie in der Gemeinde verpflichtet. Eine landesherrliche
Kommission, die in Fragen von Magie und Aberglauben geheim ermitteln
sollte, bereiste in Abständen das Land. Soweit dies durchgesetzt
werden konnte, mussten alle Angeklagten zur Prozessführung
nach Güstrow gebracht werden. Geplant war sogar die Rekrutierung
von so genannten Rügemännern, die verdächtige Praktiken
bei der Landesherrschaft beziehungsweise bei der dörflichen
Geistlichkeit denunzieren sollten. Allerdings reagierte die Bevölkerung auf diese
Eingriffe in das gemeindliche Leben nicht wie erwünscht. Weder
Pastoren noch Untertanen fanden sich bereit, tradierte alltägliche
volksmagische Praktiken als Hexerei zu denunzieren. In Mecklenburg-Güstrow
nahm die Denunziationsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung
stark ab. Die übersteigerte Inquisition von Seiten der Obrigkeit
ließ die Popularität der Hexereibeschuldigung offenbar
sehr rasch schwinden. Kritik am Hexenprozess wurde jedoch auch von anderer
Seite laut. Durch die neuen Formen der Indiziensuche wurden geistliche
und juristische Gelehrte nun auch mit der praktischen Seite der
Hexenverfolgung bekannt. Nicht mehr aus der Abgeschiedenheit ihrer
Gelehrtenstube, sondern in der alltäglichen, unmittelbaren
Praxis agierend, erlebten sie plötzlich das persönliche
Elend der Betroffenen. Gerade in der Gruppe der kirchlichen Vertreter,
denen zudem die seelsorgerische Betreuung der Angeklagten bis hin
zur Begleitung auf den Scheiterhaufen zufiel, regten sich bald ablehnende
Stimmen. Besonders der Güstrower Superintendent Hermann
Schuckmann († 1686) übte massive Kritik an der Besagung
und Anwendung der Folter und beanstandete die "Kaltsinnigkeit"
der Juristen. Er konnte sich mit seiner Stimme offensichtlich Gehör
beim mecklenburgischen Herzog Gustav Adolf verschaffen. Ab 1680
wurden hier die Hexenprozesse nach und nach eingestellt. Ganz im
Sinne Luthers urteilten die Gelehrten 1683 schließlich: Aussagen
nachzugehen, die auf den Einflüsterungen des Teufels beruhten,
etwa die Teilnahme am Hexensabbat, bedeute nichts anderes als ob
man magiam per magiam erforsche. Die umfassende Aberglaubenskritik
führte zur Erkenntnis, dass auch der Glaube an Hexen letztlich
ein ‚Aberglauben' sein musste. Das Herzogtum Güstrow übernahm damit in
Norddeutschland die Vorreiterrolle bei der Beendigung der Verfolgung.
Erst 20 Jahre und viele Opfer später wurden die Verbrennungen
auch in den anderen Territorien eingestellt. Dies bedeutete anders
als in Mecklenburg-Güstrow jedoch nicht die Abkehr vom Hexenglauben
und von der Möglichkeit, Hexen gerichtlich zu verfolgen. Lediglich
die prozessualen Grundlagen wurden verbessert. Man durchleuchtete
nun die erhobenen Vorwürfe genauer, forschte auch nach natürlichen
Ursachen von Krankheiten und außergewöhnlichen Erscheinungen.
Nur äußerst selten gestatteten die Juristen von nun an
die Anwendung der Folter. Ohne die physischen Qualen konnten die
vermeintlichen Hexen auch nicht mehr zum Geständnis ihrer angeblichen
skandalösen Untaten getrieben werden und mussten daher als
unschuldig gelten. Außerdem gerieten auf diese Weise keine
weiteren Personen mehr in den fatalen Teufelskreis von Besagung
und Prozess. Dem Hexenprozess wurde damit die prozessrechtliche
Basis entzogen und den nachbarlichen Klägern teilweise sogar
mit Strafen gedroht. Es wurde unattraktiv, soziale Konflikte in
Form von Hexereibezichtigungen vor Gericht auszutragen. |
|
|
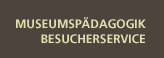 |