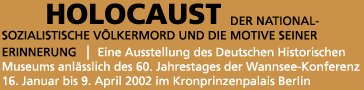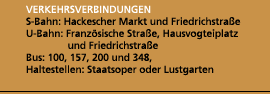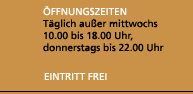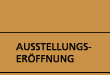
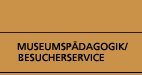

|
Am 20. Januar 2002 jährt sich zum sechzigsten Mal der Tag, an dem in einer Villa am Berliner Wannsee die organisatorisch-technische Durchführung der "Endlösung der Judenfrage" beraten wurde. Aus diesem Anlass zeigt das Deutsche Historische Museum eine Ausstellung zum Holocaust, dem nationalsozialistischen Völkermord an sechs Millionen Juden. Neben der Darstellung dieses beispiellosen Verbrechens setzt sich diese Ausstellung auch mit den Motiven der Erinnerung an den Holocaust nach 1945 auseinander. Das Konzept wurde zusammen mit der Stiftung Topographie des Terrors, der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, dem Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst sowie mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten erarbeitet. Die Ausstellung mit einer Gesamtfläche von rund 800 m² ist in zwei große Bereiche untergliedert: Im ersten Teil wird die nationalsozialistische Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik gegenüber Juden und anderen Gruppen bis zum Kriegsende 1945 dargestellt, während es im zweiten Teil vor allem um die Frage nach dem Umgang mit dem Holocaust und den Motiven seiner Erinnerung in Deutschland nach 1945 geht. Um die weit über Deutschland hinaus reichenden Auswirkungen des Holocaust vor Augen zu führen, werden das Museum Auschwitz-Birkenau, die Gedenkstätte Yad Vashem sowie das U. S. Holocaust Memorial Museum in Washington mit ihrer Sicht auf den nationalsozialistischen Völkermord vorgestellt. Eine einführende Multivision bietet einen Überblick über die Thematik der gesamten Ausstellung. Im Treppenaufgang des Kronprinzenpalais vermittelt eine Collage von Fotografien aus den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts einen Eindruck von der kulturellen Vielfalt jüdischen Lebens im Europa jener Zeit. Der erste Ausstellungsraum veranschaulicht die Emanzipation und Assimilation der in Deutschland lebenden Juden am Beispiel ihrer Beteiligung am Ersten Weltkrieg und betont ihre Bedeutung für zentrale Bereiche des gesellschaftlichen Lebens trotz des sich radikalisierenden Antisemitismus in der Weimarer Republik. Im zweiten Raum werden jene nationalsozialistischen Maßnahmen aufgezeigt, die im "Dritten Reich" den Auftakt zur staatlich angeordneten Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung von Juden und anderen Menschen bildeten, die nicht den NS-Rassevorstellungen entsprachen. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die jüdische Bevölkerung und deren Ringen um Selbstbehauptung und Überleben stehen in diesem Raum im Vordergrund. Der dritte Raum beschäftigt sich mit dem Angriff auf Polen, der "Euthanasie", dem "Generalplan Ost" und den nationalsozialistischen Plänen zur millionenfachen Vernichtung "slawischer Untermenschen" in Osteuropa durch Hunger. Die existentielle Bedrohung jüdischer, aber auch nichtjüdischer Menschen nach Beginn des Zweiten Weltkrieges sowie die Einrichtung von Ghettos für die jüdische Bevölkerung und ihre Versuche, unter diesen kaum vorstellbaren Extrembedingungen zu überleben, sind hier die thematischen Schwerpunkte. Die Umsetzung der "Endlösung der Judenfrage" und ihre Konsequenzen für die europäischen Juden stehen im Mittelpunkt des vierten Raums. Das enthemmte Morden nach dem Überfall auf die Sowjetunion, dem erste Vergasungen und die Massenerschießungen von Juden durch die Einsatzgruppen folgten, zeugt von einer bis dahin für kaum denkbar gehaltenen Bereitschaft zur Vernichtung. Unter Einbeziehung zentraler Reichsbehörden wurde wenig später auf der Wannsee-Konferenz die technisch-organisatorische Durchführung des geplanten Völkermords an den europäischen Juden besprochen. Bedrückende Bilder von Deportationen unzählbarer Menschen aus dem "Altreich" und aus den von Deutschland besetzten Gebieten in die Vernichtungslager führen das Leid derjenigen vor Augen, die als Juden oder als Sinti und Roma dem nationalsozialistischen Rassenwahn und seiner Mordmaschinerie zum Opfer fielen. Ein von dem polnischen
Bildhauer Mieczyslaw Stobierski bereits kurz nach Kriegsende entworfenes
Modell des Krematoriums II des Lagers Auschwitz-Birkenau verdeutlicht
den Charakter der "Todesfabrik Auschwitz", die zum Synonym
für den "industriell" durchgeführten Völkermord
geworden ist. Doch auch das Leben in den Lagern sowie jüdischer
Widerstand und jüdisches Leben im Untergrund werden mit aussagekräftigen
Objekten - wie etwa den Gemälden von Felix Nussbaum - veranschaulicht.
Ausschnitte von Filmen über die Befreiung der Konzentrationslager
beenden den ersten Teil des Rundgangs. Mit den Bildern befreiter KZ-Häftlinge endet jedoch noch nicht die Ausstellung, denn die Geschichte des nationalsozialistischen Völkermords reicht weit über den 8. Mai 1945 hinaus. Deshalb ist der zweite Ausstellungsteil der Frage nach dem Umgang mit dem Holocaust und den unterschiedlichen Motiven seiner Erinnerung nach 1945 gewidmet. Gezeigt wird die politische, juristische und gesellschaftliche "Vergangenheitsbewältigung" im Nachkriegsdeutschland unter alliierter Besatzung sowie in der DDR und der Bundesrepublik. Während zahllose Überlebende des Holocaust als Displaced Persons auf der Suche nach einer neuen Heimat waren, gab es zaghafte Versuche eines Neubeginns jüdischen Lebens in Deutschland. Gleichzeitig prägten Entnazifizierungsverfahren und Strafprozesse das Leben von Tätern in einem gesellschaftlichen Umfeld, das vor allem vom Wunsch nach Verdrängung gekennzeichnet war. Der schwierige Umgang mit der Erinnerung an den Völkermord spiegelt sich bis in die Gegenwart in kontroversen Diskussionen und politischen Auseinandersetzungen. Die Ausstellung zeichnet die Reflexion des Holocaust in der Bildenden Kunst, der Literatur, dem Theater und im Film anhand ausgewählter Beispiele nach. Ebenfalls beleuchtet wird die Diskussion um "Wiedergutmachung" bis hin zur aktuellen Problematik der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Doch auch der nach 1945 immer wieder hervortretende Antisemitismus bleibt nicht ausgespart. Der letzte Raum der Ausstellung lenkt den Blick auf den Umgang mit dem Holocaust in drei Ländern, deren Geschichte auf ganz unterschiedliche Weise mit dem nationalsozialistischen Völkermord verknüpft ist. In enger Zusammenarbeit mit dem Museum Auschwitz-Birkenau (Polen), der Gedenkstätte Yad Vashem (Israel) sowie mit dem U. S. Holocaust Memorial Museum (USA) werden Entstehung und Entwicklung sowie die Bedeutung dieser drei Institutionen für die - nicht nur jüdische - Bevölkerung in dem jeweiligen Land vor Augen geführt. Der Ausstellungsrundgang endet mit Sequenzen aus Filmen, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzen. An interaktiven PC-Stationen können Besucher einzelne Aspekte der Geschichte des nationalsozialistischen Völkermords vertiefen. Ergänzt durch ein umfangreiches Begleitprogramm, soll die für ein breites Publikum konzipierte Ausstellung nicht nur die grausamen Konsequenzen des nationalsozialistischen Antisemitismus und Rassismus aufzeigen, sondern sie versucht damit zugleich, zum Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen fremder Kultur und Religion oder anderer Hautfarbe beizutragen. Weitere Informationen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |