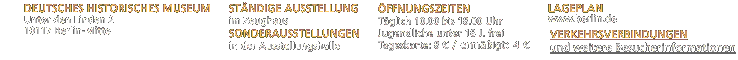Restaurierungsabteilung | Restaurierung eines Gemäldes | "Das Türkenzelt"
Bekämpfung von Textilschädlingen mit Kohlenstoffdioxid | "Marie und Marie" | Jahreszeitenbilder
Restaurierung eines Plakates |
|---|
Die markierten Bereiche führen Sie zu einzelnen
Restaurationsschritten.
|

Die Restaurierung gehört zu den wichtigen Arbeiten des modernen Museums: Viele Exponate können ohne Bearbeitung durch die Restauratoren überhaupt nicht ausgestellt werden. Andere würden ohne konservierende Maßnahmen binnen kurzer Zeit für immer verloren gehen.
Die Restaurierung geht immer so behutsam wie möglich mit dem Exponat um. Die Eingriffe in das Original versuchen die Restauratoren sehr gering zu halten, um soviel Originalität zu erhalten wie möglich. Den Charakter eines Objektes erhalten, aber gleichzeitig den Verfall aufhalten, heißen die Ziele.
Das Objekt, das die Restaurierung verläßt, soll nicht wie neu erscheinen. Schäden wie Risse, Knicke oder Brandstellen gehören zur Geschichte eines Exponates und werden nach einer Restaurierung mit Sicherheit repariert sein; trotzdem sieht das Bild bestimmt nicht so aus als hätte es die Schäden nie gegeben. Die folgenden Arbeitsschritte zeigen die Gratwanderung eines Restaurators.
Am Beispiel des Werbeplakates " Parkrestaurant Landhaus " lassen sich exemplarisch die verschiedenen Arbeitsschritte einer umfassenden Plakatrestaurierung und -konservierung darstellen. Das Plakat stammt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus der Sammlung Sachs. Hans Sachs, Herausgeber der Zeitschrift "Das Plakat", sammelte bis 1938 über 12.800 Plakate. Seine Sammlung gehörte zu den größten Dokumentationen der Plakatkunst der zwanziger und dreißiger Jahre.
1938 wurden fast sämtliche Exponate von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Dabei ging die zugehörige Kartei verloren, so daß eine genaue Datierung des Objektes bisher schwer möglich ist. Der weitere Weg der Sammlung Sachs liegt bisher im dunkeln. Erst 1953 beim Umzug des Museums für Deutsche Geschichte (MfDG) in die Clara-Zetkin-Straße fanden Mitarbeiter in einem Kellergewölbe in graues Papier gerollte Plakate, die ein Mitarbeiter als Teile der Sachs-Sammlung erkannte.
Die Restaurierung des hier beschriebenen Objektes in der Abteilung Graphik- und Plakatrestaurierung hat der Restaurator Matthes Nützmann 1995 durchgeführt und ausführlich dokumentiert.
|

Zustandsbeschreibung "Vor der Restaurierung" |
|---|
Zustand anhand des Protokolls
Das Plakat aus dem Bestand des ehemaligen Museums für Deutsche Geschichte (MfDG) war in einem desolaten Zustand: Durch die natürliche Alterung des säurehaltigen Holzschliffpapiers war das Werbeplakat aus den zwanziger Jahren stark vergilbt und verbräunt. Da die Holzfasern des Papiers sich mit der Zeit zersetzt hatten, wurde der gesamte Papierkörper brüchig; dieser Verfall hatte zu einigen gravierenden Fehlstellen geführt.Vor allem die Ränder des Blattes waren davon betroffen.
Das Plakat zeigte deutliche Brandspuren. Diese lassen sich vermutlich auf zwei Lagerbrände von 1925 und 1926 zurückführen. Das Löschwasser, das das Objekt vor dem Feuer rettete, führte zu Wasserrändern, und es bildete sich großflächig Schimmelbelag auf Vorder- und Rückseite. Der Schimmelpilz führte zu Substanzabbau und Entzug der inneren Leimung des Blattes an den betroffenen Stellen; dadurch wurde das Papier weiter destablilisiert.
Durch Knicke, Risse und Falten war das Plakat mechanisch schwer beschädigt, was durch die natürliche Alterung und die Fehlstellen noch weiter verstärkt wurde. Eine laienhafte Reparatur, die vor Jahrzehnten noch mit Naßklebebändern ausgeführt worden war, hatte den Zerfall nicht stoppen können. Darüber hinaus war das Papier mit einer dicken Staubschicht überzogen und stark verschmutzt.
Die genaue Skizze sämtlicher Schäden gehört zwingend zum dokumentierenden Teil einer Restaurierung.
|

Trockenreinigen |

Nach der detaillierten Dokumentation des Zustandes werden die ersten restauratorischen Maßnahmen ergriffen: Die Oberfläche des Blattkörpers wird trocken, das heißt mechanisch, gereinigt. Verschmutzungen und in diesem speziellen Fall Schimmel werden mit einer Art "Radiergummi" so weit wie möglich abgenommen.
Da der eigentliche Blattkörper nicht geschädigt werden soll, muß auch bei dieser "groben" Art des Reinigens akribisch und vorsichtig vorgegangen werden. Schließlich dürfen nicht etwa Farbe oder einzelne Papierschichten "wegradiert" werden. Dieser Prozeß dauert bei stark verschmutzten Oberflächen labiler Papiere einige Stunden.
|

Naßreinigen |
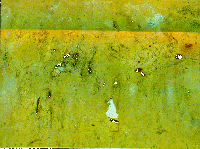
Bei der Naßreinigung eines Plakates, das auf altem Industriepapier gedruckt wurde, hat der konservierende Aspekt mehr Gewicht als der visuelle. In diesem Arbeitsgang wird zuerst die Oberfläche des Papiers in einem Warmwasserbad von hartnäckigem Schmutz und Wasserrändern befreit.
Entscheidend für den Fortbestand des Objektes sind jedoch die Entsäuerung und die alkalische Pufferung des Trägerpapiers. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde industriell hergestelltes Papier zunehmend aus Holzfasern mit einer Harz-Aluminiumsulfat-Leimung gefertigt. Das Aluminiumsulfat bildet jedoch mit der natürlichen Luftfeuchte Schwefelsäure, die die Cellulosemoleküle in den Holzfasern zerstört. Das Papier wird spröde und brüchig bis zum völligen Zerfall.
Der Restaurator neutralisiert zuerst die Schwefelsäure mit einer Calciumhydroxidlösung. Dann wird mit Calciumcarbonatlösung oder Magnesiumcarbonatlösung im Papier ein alkalischer Puffer angelegt, der die Neubildung von Schwefelsäure für lange Zeit verhindert.
|

Stabilisieren |

Nachdem das Plakat sowohl trocken als auch naß gereinigt wurde, wird der chemisch geschützte Papierkörper mechanisch stabilisiert. Das Papier soll soweit wie möglich wieder einen geschlossenen Körper bilden, um stabil zu bleiben. Dazu werden Risse geschlossen, eventuelle Fragmente wieder eingesetzt und Fehlstellen ergänzt.
In diesem Fall wurde die Fehlstelle "angefasert". Bei dieser Methode verwendet man eine Papierfaserlösung, die an das Objekt "angegossen" wird. An einem Saugtisch entstehen so die fehlenden Blattpartien aus "flüssigem Papier".
Farbunterschiede zwischen dem Originalpapier und dem "angefaserten" Teil werden bewußt eingesetzt, um den Eingriff in das Exponat auch für den Laien sichtbar zu machen.
Um das insgesamt brüchige Plakat zu festigen, wird es abschließend kaschiert: Auf die Rückseite des Papiers wird eine dünne Schicht Japanpapier aufgebracht, und das Plakat wird gegebenenfalls nachgeleimt. Neben der restauratorischen Wirkung haben alle diese Maßnahmen auch einen konservatorischen Grund: Das Plakat soll auf diese Weise so schonend wie möglich vor den Folgen der Alterung geschützt werden.

|

Retuschieren |
Ein Restaurator wird immer bemüht sein, daß ein von ihm restauriertes Objekt "authentisch" bleibt. Das heißt: Er muß den Beschädigungen als Teil des Objektes ebenso Rechnung tragen, wie dem früheren, unbeschädigten Zustand. Demzufolge wird er so wenig wie möglich in das Objekt eingreifen. Andererseits geht es ihm neben den wichtigen konservatorischen Kriterien auch um ästhetische Gesichtspunkte. Hier wird im Einzelfall entschieden, wie weit die Restaurierung gehen muß, um das Objekt zu erhalten. Nach ästhetischen und gleichzeitig ethischen Gesichtspunkten werden Retuschen nur mit Bedacht und sehr behutsam vorgenommen.
Dabei müssen alle restauratorischen Maßnahmen nachvollziehbar bleiben. Nachvollziehbarkeit meint in diesem Zusammenhang, daß zum Beispiel Ergänzungen durch einen leicht unterschiedlichen Papierton sichtbar gemacht werden. Die Restaurierung soll sich dem Objekt anpassen und unterordnen. Das Original darf auf keinen Fall verfälscht oder von den restaurierten Stellen dominiert werden.
Behutsam nähert sich der Restaurator mit seiner Arbeit dem Original an, ohne zu kopieren oder eigenmächtig zu verändern. Selbst beim Retuschieren kann durch Mal- und Zeichentechniken, die sich von denen des Originals unterscheiden, die Authentizität gewahrt werden. Im Fall des Plakates "Parkrestaurant Landhaus" sollen originale und retuschierte Stellen für den Betrachter differenzierbar bleiben, dabei aber doch harmonisieren.
Ein restauriertes Objekt wird nicht den optischen Eindruck wiedererlangen, den es vor seiner Beschädigung hatte, sondern eine gute Restaurierung wird sich diesem Eindruck auf nachvollziehbarem Weg sinnvoll annähern und dabei gleichzeitig konservierend tätig sein.
|

|