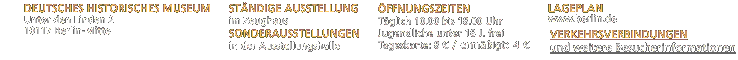Sammlungen des Deutschen Historischen Museums
Alltagskultur II › Kleidung/Textilien › Bestandsauswahlvorheriges Objekt | nächstes Objekt

- Titel: Dienstkleidung einer Helferin des Deutschen Roten Kreuzes nach der ab 1. Januar 1938 gültigen Dienstvorschrift für die Schwesternschaften des DRK (Kleid mit Kragen, Brosche und Schürze, die dazugehörige Überhaube U 93/257 ist nicht abgebildet)
- Datierung: 1938/1945
- Material: Baumwolle, Metall, Kunststoff (Schwesternkleid)
- Größe: L: 115 cm (Schwesternkleid)
- Inventar-Nr.: U 93/258, U 93/259
Im Jahre 1859 nahm Henry Dunant als Beobachter an der Schlacht bei Solferino in Oberitalien teil. Seine Eindrücke vom Leid der Soldaten schrieb er nieder. Er forderte zukünftig eine umfassende medizinische Versorgung verwundeter Soldaten ohne Rücksicht auf ihre Nationalität. 1864 fand auf seine Initiative hin die Gründung des „Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“ in Genf statt. Dieses rief in zahlreichen Ländern Rotkreuz-Vereine ins Leben. In Deutschland schlossen sich nach dem Krieg von 1866 viele Frauenvereine dem Roten Kreuz an und bildeten sogenannte Rotkreuz-Schwesternschaften. Ihre Hauptaufgabe bestand in der Ausbildung von Krankenpflegerinnen. Eine verbindliche, einheitliche Dienstkleidung gab es noch nicht. Übereinkunft herrschte über die Rotkreuz-Armbinde: Sie wurde erstmals 1864 von dem Kriegschirurgen Louis Appia getragen und als Neutralitätszeichen für Verwundete, Kranke und das Pflegepersonal vereinbart.
Der zunehmende Missbrauch des Rotkreuz-Zeichens begann das Ansehen der Schwestern zu schädigen. Ideen zu signifikanten Erkennungszeichen, wie einem Medaillon, oder einem verbindlichen Accessoire, der Haube entstanden. 1899 bat der Verband beispielweise darum, „unsere charakteristische Haube ohne Ohrenbänder und ohne Kinnschleife“ zu tragen, um Verwechselungen mit der Kopfbedeckung der Diakonissen auszuschließen. Im selben Jahr wurden auch Anforderungen an eine Schwesterntracht aufgestellt: „... sie musste bequem und haltbar und bei jeder Art Waschen und Desinfektion, tragbar für Winter und Sommer sein, sie musste kleidsam sein, ohne mühsame Arbeit durch Plätten etc. zu erfordern; sie musste leicht verschiedenen Gestalten sich anpassen“ (Das Rothe Kreuz, 17. Jg. Nr. 10, 15.5.1899, S. 106).
Am 27. Januar 1907 genehmigte Kaiser Wilhelm II. im Rahmen einer neuen „Kriegs-Sanitäts-Ordnung“ zwei Dienstkleidungs-Entwürfe für den Kriegsfall: einen „Pflegeanzug“ und einen „Straßenanzug“ für eine Armeeoberschwester vom Roten Kreuz. Bei ihrer Arbeit sollte sie ein graues Waschkleid mit weißem Kragen, weißen Manschetten, weißer Schürze und weißer Haube tragen.
1912 wurde in Preußen e ine allgemeine „gesetzlich geschützte gemeinsame Diensttracht für Schwestern, Hilfsschwestern und Helferinnen vom Roten Kreuz“ eingeführt: Die Arbeitskleidung für Schwestern und Hilfsschwestern bestand aus weißer Haube mit rot bestickter Rotkreuz-Borte, grauem, aus der Krankenpflege bekanntem Arbeitskleid und vorgeschriebener Brosche. Helferinnen unterschieden sich durch ein grau-weiß gestreiftes Kleid aus Waschstoff.
In Berlin hatten sich gleich zwei Wäsche-Kaufhäuser auf Schwesterntrachten spezialisiert. Heinrich Jordan in der Markgrafenstraße 102/107 bezeichnete sich in einer Anzeige von 1912 als „einzige Verkaufsstelle der vom Verband deutscher Krankenpflegeanstalten vom Roten Kreuz eingeführten Schwestern-Kleiderstoffe, Armstreifen, Abzeichen, Haubenband usw. zu vereinbarten Preisen“. Der graue Baumwollstoff sollte beispielsweise bei einer Abnahme von mindestens 500 Metern noch 0,58 Mark pro Meter kosten.
Unter nationalsozialistischer Herrschaft wurde das Deutsche Rote Kreuz auf die enge Zusammenarbeit mit der Wehrmacht reduziert. Das „Gesetz über das Deutsche Rote Kreuz“ vom 9.12.1937 überführte es in eine zentralistische Gesamtkörperschaft zur „Bewältigung der großen wehrpolitischen Aufgaben“. Neue Bekleidungsvorschriften galten ab Januar 1938: Die Bestimmungen enthielten die Vorschriften für die Friedens- wie für die Kriegstracht.
Krankenschwestern vom Deutschen Roten Kreuz arbeiteten im Zweiten Weltkrieg in der Kriegskranken- und Verwundetenpflege, etwa 500.000 waren außerdem als „Wehrmachtshelferinnen“ für die Betreuung der Truppen zuständig.