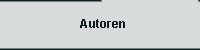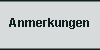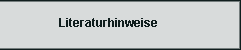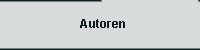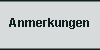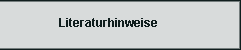|
Die preußische
und die Kaiserliche Marine
in den ostasiatischen Gewässern:
Das militärische Interesse an Ostasien
von Michael Salewski
Die "Berliner Illustrirte
Zeitung" machte am 10. April 1898 mit den ersten "Bildern aus Kiautschou"
auf. "Von allen überseeischen ›Erwerbungen‹", hieß es gleich einleitend,
"die sich das Deutsche Reich, seitdem es seinen Beruf für eine Kolonialmacht
entdeckt, zugelegt hat, ist keine in so kurzer Zeit so populär geworden,
wie unsere ›Pachtung‹ in China, Kiautschou. In diesem Zeichen gingen
zwei Drittel aller Kostümfeste des verflossenen Winters in Scene,
die Coupletdichter stürzten sich mit wahrer Wonne auf den ›dankbaren‹
Stoff, und auch die Industrie ging nicht ganz daran vorüber. Und
während der Deutsche im allgemeinen unsern Kolonien recht kühl gegenübersteht,
für Kiautschou hat auch der Oppositionsmann etwas übrig. Um so mehr
als die anfänglichen befürchteten kriegerischen Verwicklungen ausgeblieben
sind …"1
Im gleichen Jahr erschien der Reisebericht jenes Geheimen Marine-Hafenbaudirektors
in Kiel, Georg Franzius, dessen positives Votum für Kiautschou den
letzten Ausschlag zur "Erwerbung" der Bucht geliefert hatte unter
dem Titel: "Kiautschou. Deutschlands Erwerbung in Ostasien". Innerhalb
eines halben Jahres wurde das Buch in vier Auflagen verbreitet -
aber daran war nicht Franzius noch dessen farbenfroher Bericht,
sondern kein Geringerer als der Kaiser persönlich "schuld", denn
dieser hatte nicht nur das Geleitwort beigesteuert, sondern auch
den Entwurf zur Einbanddecke und einige geradezu phantastische Bilder.
"Wo ein deutscher Mann in treuer Pflichterfüllung für sein Vaterland
fallend begraben liegt", so setzte Wilhelm II. ein faksimiliertes
Autograph hinzu, "und wo der deutsche Aar seine Fänge ins Land geschlagen
hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben!"2
Es kommt nicht von ungefähr, daß die Worte "Pachtung" und "Erwerb"
von der Presse in Anführungszeichen gesetzt wurden: Nachdem der
"Reichsanzeiger" am 5. Januar 1898 die Festsetzung in Kiautschou
amtlich verkündet hatte, war die Öffentlichkeit davon überzeugt,
daß die Bucht ein für allemal deutsch geworden war. Wilhelm II.
ließ keinerlei Zweifel daran, daß die Zukunft Tsingtaus militärisch
bestimmt sein würde, das zeigte schon die bei Franzius abgedruckte
eigenhändig gezeichnete vergleichende Flottenliste des Kaisers.
Sie trug das Datum "Februar 1898". In drei sauber untereinander
gezeichneten Kolonnen von Schiffssilhouetten erschienen die "Seestreitkräfte
Japans, Deutschlands und Rußlands in Ostasien". 14 japanische und
14 russische Kriegsschiffe aller Klassen rahmten 8 deutsche ein
- wer wollte, konnte aus dieser kaiserlichen "Maling" (Zeichnung)
Realität und Programm der deutschen Ostasienpolitik schon ableiten.3
In Wirklichkeit sollte die deutsche Festsetzung in Kiautschou nicht
den Anfang, sondern eher schon das Ende des deutschen überseeischen
Ehrgeizes in Ostasien markieren, auch wenn die Verantwortlichen
genau dies hofften und glaubten. "Am Sonntag, den 14. November erfolgte
die Besitzergreifung. ›Kaiser‹ und ›Prinzeß Wilhelm‹ gingen in der
kleinen Bucht von Tsingtau vor Anker, um ihre hier an der Brücke
landenden Truppen zu decken, während ›Cormoran‹ in die Bucht von
Kiautschou bis zum Horse-shoe Riff lief, um den chinesischen Truppen
von Norden her in den Rücken zu fallen und besonders die Munitionshäuser
zu besetzen. Das aus 30 Offizieren, 77 Unteroffizieren und 610 Mann
bestehende Landungskorps war überrascht, am Lande nicht den geringsten
Widerstand zu finden. Noch überraschter aber waren dann die 1600
bis 2000 Mann zählenden Chinesen, als sie plötzlich ihre Munitionshäuser
und Lager von unsern Truppen besetzt sahen …"4
Konteradmiral Diederichs ließ um 21/2 Uhr die deutsche Flagge "mit
drei Hurrahs auf seine Majestät den Kaiser" hissen und erließ folgende
Proklamation: "Ich, der Chef des Kreuzergeschwaders, Kontreadmiral
v. Diederichs, mache hiermit bekannt, daß ich auf Allerhöchsten
Befehl seiner Majestät des deutschen Kaisers die Kiautschoubucht
und die vorliegenden Inseln … besetzt habe. Dies geschieht, um Bürgschaft
zu haben, für die Erfüllung der Sühneforderungen, welche an die
chinesische Regierung wegen der Ermordung deutscher Missionare in
Shantung gestellt werden müssen."5
Die Ermordung zweier Steyler Missionare hatte bekanntlich als lang
erhoffter Vorwand dienen müssen, um sich in Kiautschou gewaltsam
militärisch festzusetzen, aber ohne eine lange diplomatische, seestrategische
und technische Vorbereitung wäre dieser Coup kaum möglich gewesen.
Wenn den Verantwortlichen in Berlin dennoch alles andere als wohl
war, das Oberkommando der Marine in fliegender Hast einen Operationsplan
gegen Japan entwarf,6 die recht massiv
vorgetragenen russischen Proteste das Auswärtige Amt höchst unangenehm
berührten,7 so zeigte dies nur, auf
welch schmalem Grat sich schon die Anfänge der deutschen "Weltpolitik"
bewegten.8
Ob das Deutsche Reich überhaupt jemals in der Lage sein konnte,
es den großen anderen europäischen Mächten, vor allem also England,
Rußland, Frankreich, aber auch den Niederlanden, im Erwerb überseeischer
Stützpunkte und Kohlestationen gleichzutun, war eine Frage, die
sich schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Berlin gestellt
hatte.
Die von Friedrich dem Großen privilegierte "Königlich Preußische
Asiatische Handlungs-Compagnie von Emden auf China" ließ in den
kurzen Friedensjahren zwischen dem 2. und dem 3. Schlesischen Krieg
ein rundes Dutzend Mal mit eigenen Schiffen Kanton anlaufen; bekannt
geworden ist die Fahrt der "König von Preußen", "bemannt mit 120
Matrosen und 12 Grenadieren und bestückt mit 36 Kanonen".9
Die Geschäfte waren einträglich und ließen sofort den Wunsch nach
staatlicher Unterstützung wach werden, aber die europäischen Wirren
des nachfolgenden knappen Jahrhunderts machten für Preußen und die
übrigen deutschen Staaten den Erwerb irgendwelcher asiatischer Stützpunkte
völlig unmöglich; nicht ohne Neid mußte man die erfolgreichen französischen,
niederländischen, vor allem aber englischen Bemühungen um ein Fußfassen
in China und Südostasien verfolgen. Erst mit den politischen und
militärischen Folgen der Revolution von 1848 begann eine eigenständige
preußische Marine- und Stützpunktpolitik; der geistige Vater war
neben Friedrich List Adalbert von Preußen, dessen berühmte Denkschrift
von 1848 zur "Magna Charta" der deutschen Marinegeschichte wurde.10
"6 Fregatten von 60 Kanonen", so meinte er, seien völlig ausreichend
"um, mit Ausnahme Nordamerika's, mit allen anderen Staaten der neuen
Welt Krieg zu führen; denn keiner derselben kann uns mehr Streitkräfte
entgegenstellen. Ebenso würden wir unserer jungen Flagge in den
chinesischen Gewässern diejenige Achtung nöthigenfalls erzwingen
können, deren dort die anderen seefahrenden Nationen bereits genießen."11
Das war 1848 nur Zukunftsmusik, aber die Frage nach der preußischen
Marinepräsenz in Ostasien war seitdem nicht mehr verstummt, und
es fehlte im kommenden Jahrzehnt nicht an allerlei Projekten,12
in denen Nord- und Südamerika, die Inselwelt des Pazifischen Ozeans,
vor allem aber China, Siam und Japan die wichtigste Rolle spielten.
Dabei ging es um Flotten- und/oder Kohlestationen; nachdem der Krimkrieg
endgültig erwiesen hatte, daß die Zukunft der Marine bei den kohlebefeuerten
Dampfschiffen liegen würde,13 wurden
entsprechende Kohle-Stützpunkte zur zwingenden Notwendigkeit, wollte
man außerhalb der engen Heimatgewässer mit Seestreitkräften operieren.
Der Staatssekretär des Reichsmarineamtes, Vizeadmiral Hollmann,
definierte: "Unter Flottenstationen sind gesicherte Plätze im Auslande
verstanden, welche, unter deutscher Gebietshoheit stehend, unseren
Schiffen jederzeit die Möglichkeit gewähren, ihren Bedarf an Proviant,
Kohlen, Munition, wie überhaupt an Vorräten jeglicher Art, zu decken.
Werkstätten, Docks, Hellinge sollen die Ausführungen von Reparaturen,
Lazarette die Aufnahme von Kranken und Verwundeten, Kasernements
die Unterbringung von Ersatzmannschaften für die Schiffe ermöglichen.
Im Kriege bilden die Stationen die Basis für alle Unternehmungen,
sie dienen der Flotte als Sammelpunkt und Rückhalt, den Handelsschiffen
als sichere Zufluchtsstätte."14
Damit war das Idealziel umschrieben. In Wirklichkeit mußten sich
die preußischen Schiffe in Ostasien auf englisches und französisches
Wohlwollen und deren maritime Infrastruktur in den "Vertragshäfen"
stützen. Diese waren sowohl in Siam und Japan wie auch in China
Resultat jener "ungleichen Verträge", die nach dem englischen Einbruch
nach China auf scheinlegale Weise den schwächlichen Regimes in diesen
Ländern abgenötigt worden waren. Der eigentliche Paukenschlag erfolgte
1853 mit der mehr oder weniger gewaltsamen Öffnung Japans durch
das amerikanische Geschwader des Kommodore Perry,15
in dessen Gefolge ein wahrer Run der europäischen Mächte nach Ostasien
einsetzte. Die preußische Ostasienexpedition, die zumeist den Namen
des preußischen Gesandten Graf Eulenburg trägt, fügte sich in dieses
Muster und verschaffte Preußen-Deutschland16
das eigentliche machtpolitische Entrée nach Ostasien; man kann durchaus
behaupten, daß diese Unternehmung, die ein gut Teil der preußischen
maritimen Ressourcen in Anspruch nahm, der vorweggenommene Auftakt
der deutschen "Weltpolitik" war, wie sie mit der "Erwerbung" Kiautschous
ins allgemeine politische Bewußtsein der Nation trat.17
Dabei waren nicht so sehr die von Eulenburg erreichten Vertragsabschlüsse
mit Japan, China und Siam ausschlaggebend, zumal Preußen die Sprachregelung
ausgab, man wolle "nur" Handel treiben und hege keinerlei machtpolitische
Ambitionen, als vielmehr die langfristigen personellen Konsequenzen
dieses Unternehmens: Der Gesandte Eulenburg wurde Bismarcks Innenminister,
der Expeditionsarzt Lucius war kein anderer als Bismarcks Minister
Lucius von Ballhausen, der Attaché Max von Brandt wurde Gesandter
in Japan und China und avancierte in der "heißen" Phase des Kiautschou-Coups
zur grauen Eminenz im Auswärtigen Amt; Freiherr von Richthofen,
der Geograph, begründete wesentlich die Theorie des deutschen Imperialismus.
"Von den 64 Seeoffizieren, Kadetten usw., die den vier Schiffen
der Expedition zugeteilt waren, rückten nicht weniger als 23 im
Laufe der Jahre zu Admirals- oder Generalsrang auf; zwei von ihnen,
Vizeadmiral Heusner und Admiral Hollmann, übten zu verschiedenen
Zeiten das Amt des Staatssekretärs des Reichsmarineamtes aus."18
Das heißt: Ein beträchtlicher Teil jener führenden politischen und
militärischen Elite, die seit Bismarcks Ernennung zum preußischen
Ministerpräsidenten 1862 das Deutsche Reich schuf, hatte unmittelbare
persönliche Erfahrungen mit dem Fernen Osten. Alle Entscheidungen
fielen daher nicht vom grünen Tisch der Theorie, sondern auf Grund
sehr exakter politischer, militärischer, wirtschaftlicher, kultureller,
aber auch geographischer und strategischer Erfahrungen. Das unterschied
die deutsche Kolonialpolitik in Ostasien fundamental von jener in
Afrika oder im pazifischen Raum. Wenn die Deutschen später an Tsingtau
mit ihrem Herzblut hingen, so kann man das fast wörtlich nehmen,
war doch ein Drittel der Expeditionsteilnehmer 1860/61 ums Leben
gekommen. Der Untergang des Schoners "Frauenlob" im Taifun wirkte
noch jahrzehntelang wie ein Vermächtnis, das Kaiser und Reich zu
wahren hatten. Wenn die praktische Tagespolitik betreffs Ostasiens
im Auswärtigen Amt ein Vierteljahrhundert später eher dilettantisch
betrieben wurde,19 so blieb sie doch
hochemotionalisiert.
Daß es der preußischen Politik 1859/60 nicht allein um günstige
Handelsverträge ging, machte der Auftrag deutlich, nach Möglichkeit
auch maritime Stützpunkte zu erwerben - sei es auf Formosa, auf
Hawaii oder in Patagonien.20 Dazu kam
es nicht, aber fortan blieb das Thema "Stützpunkt in Fernost" auf
der politischen Tagesordnung; 1868 wurden die ersten Kriegsschiffe
nach Ostasien verlegt; als die beiden Korvetten "Hertha" und "Medusa"
1869/70 in Singapur eintrafen, galt die "Ostasiatische Schiffsstation"
als offiziell gegründet,21 und in den
nachfolgenden Jahren blieb die preußische, dann kaiserliche Marine
mit einer Handvoll Auslandskreuzer in den japanischen und chinesischen
Gewässern präsent. Schon in den politisch bewegten Zeiten der Reichseinigungskriege
wurde das Bedürfnis nach einer eigenen Flottenstation immer größer,
aber außer einem kleinen "Marine-Grund" in Yokohoma blieb das Ostasiatische
Geschwader auf das Wohlwollen vor allem Englands, Rußlands und zunehmend
Japans angewiesen. Dieser Zustand wurde als völlig unbefriedigend
empfunden, auch wenn Bismarck aus übergeordneten politischen Motiven
1865 die Weisung erteilt hatte, im Fernen Osten keine eigenständige
deutsche Kolonial- und Marinepolitik zu treiben, sondern sich ganz
nach den Wünschen der übrigen dort präsenten europäischen Großmächte
zu richten.22 Nach 1871 lag Bismarck
daran, im Fernen Osten kein Spannungsgeflecht entstehen zu lassen,
in das Deutschland auf der einen oder anderen Seite hineingezogen
werden konnte, auch wenn die ständig anwachsenden ökonomischen Interessen
des jungen Reiches in China nach einer Unterstützung und Absicherung
durch maritime Machtmittel geradezu schrien. "In Ostasien", so bedeutete
der Reichskanzler dem national-liberalen Abgeordneten Bürklin, "müssen
wir uns durch geeignete Verträge unsere Vorteile wahren. Erwerbung
von Land hat dort keinen Sinn."23
Die Marine war, natürlich, völlig entgegengesetzter Meinung, aber
die Rolle von Admiralität und Oberkommando war politisch gesehen
viel zu schwach, um eine selbständige Marine-Außenpolitik zu treiben.
Erst der doppelte "Machtwechsel" von 1888 und 1890 - Regierungsantritt
Wilhelms II., Sturz Bismarcks - ließ die politischen Aktien der
Marine steigen - jetzt sprunghaft.
Wilhelm II., der sich mit der Erwerbung Helgolands 1890 als wahrhafter
"Mehrer des Reiches" empfunden hatte, war als Verfechter des Kreuzerkriegsgedankens
mit der Problematik von Flotten- und Kohlestationen wohl vertraut
und konnte der Unterstützung durch den Chef des Reichsmarineamtes
Hollmann - einen Teilnehmer der Eulenburg-Expedition - sicher sein.
Die wachsenden Spannungen zwischen dem sich rasant modernisierenden
Japan, das nahezu aus dem Nichts binnen weniger Jahre eine moderne,
imponierende Flotte schuf, und dem anscheinend immer schwächer werdenden
China ließ die Frage nach deutschem Landerwerb in China immer dringlicher
werden, zumal man in der Wilhelmstraße davon ausging, daß zumindest
England und Rußland bei erster sich bietender Gelegenheit weitere
Stützpunkte in China zu erwerben suchen würden. Es bestand in deutschen
Augen also die Gefahr, wieder einmal zu spät zu kommen und den "Platz
an der Sonne" zu verpassen.24 Es waren
dann die Folgen des japanisch-chinesischen Krieges mit dem Frieden
von Shimonoseki, die die Dinge in Fluß brachten; die ungeschickt-unglückliche
Beteiligung Deutschlands an der Interventionspolitik des "ostasiatischen
Dreibundes" gegen Japan versetzte den bis dahin guten deutsch-japanischen
Beziehungen einen Stoß, von dem sie sich bis 1914 nicht mehr erholen
sollten, gleichzeitig aber war damit das politisch-diplomatische
Feld für den deutschen Stützpunkterwerb in China bereitet, glaubte
die Wilhelmstraße doch, daß China aus purer "Dankbarkeit" entsprechenden
deutschen Wünschen nachkommen werde. Daß das Reich im Fernen Osten
seitdem mit der Feindschaft Japans rechnen mußte, machte aber die
Stützpunktpolitik von Anfang an fraglich - es sei denn, man wollte
in Fernost eine ähnlich machtvolle seestrategische Position aufbauen,
wie dies England und - mit Einschränkungen - Rußland versuchten.
Aber damit war die Gretchenfrage gestellt: Was eigentlich wollte
die Kaiserliche Marine, was wollte die kaiserliche Marinepolitik,
in welchen größeren politischen Zusammenhängen mußte die maritime
Ostasienpolitik stehen?
Diese Fragen sind für die Zeit bis 1897 völlig anders zu beantworten
als für die Jahre von 1897 bis 1914. Die schärfste Zäsur bildet
die Ernennung von Alfred Tirpitz zum Chef des Reichsmarineamtes
im Jahr 1897. Hatte Hollmann bis dahin die Idee des Kreuzerkrieges
favorisiert, in dessen Rahmen einer Stützpunktpolitik im Fernen
Osten eine geradezu strategische Bedeutung zukam, ließ sich der
Kaiser mit der "Dienstschrift IX" vom völlig entgegengesetzten Schlachtflottenkonzept
Tirpitz' überzeugen.25 Die Festsetzung
in Kiautschou erfolgte exakt zu jenem Zeitpunkt, als das strategische
Konzept wechselte: Tsingtau bildet so betrachtet den Höhepunkt der
"Kreuzerkriegsschule" - und war zugleich ein "totgeborenes Kind",
denn im Schlachtflottenkonzept spielten außerheimische Gewässer
und Stützpunkte keine Rolle mehr. Einzig die Nordsee, genauer: das
"nasse Dreieck" der Deutschen Bucht, sollte der Schauplatz der großen
Seeschlacht und der Entscheidung sein. Die strategische Konzeption,
die nach Kiautschou führte, wurde dem Auswärtigen Amt vom Oberkommando
der Marine sorgfältig und eindringlich erläutert; Flottenstationen,
so bedeutete Hollmann dem Staatssekretär des Äußeren, Freiherrn
von Marschall, seien im Fall eines Kreuzerkrieges "geradezu eine
Existenzbedingung für die Schiffe",26
sie seien erforderlich zur "Geltendmachung des Willens", und das
Reich könne nur so "China und Japan gegenüber mächtig dastehen".27
Aber nicht nur das: In der ihm typischen, unnachahmlichen Weise
brachte es Wilhelm II. auf den Punkt, als er auf die Wegnahme von
Port Arthur durch Rußland als Folge der deutschen Festsetzung in
Kiautschou mit einem Telegramm an Nikolaus II. reagierte: "Please
accept my congratulations at the arrival of your squadron at Port
Arthur. Russia and Germany at the entrance of the Yellow Sea may
be taken as represented by St. George and St. Michael shielding
the Holy Cross in the Far East and guarding the Gates to the Continent
of Asia."28
Als Fernziel schwebte der Kreuzerkriegsschule der Ausbau von Kiautschou
als eines "Gibraltars" am Gelben Meer vor (in den Akten taucht das
Wort "Gibraltar" tatsächlich auf!), das heißt einer seestrategischen
Position, die nur dann das werden konnte, was sie sein sollte, wenn
ihr eine mächtige Kreuzerflotte entsprach. Diese sollte aus 6 Linienschiffen,
4 Küstenpanzern, 2 großen und 6 kleinen Kreuzern, 6 Kanonenbooten
und einer Torpedobootsdivision bestehen.29
"Ohne kräftigen Druck und ohne Macht, die von der Küste aus sichtbar,
ist hier gar nichts zu machen", hatte schon 1896 der forsche deutsche
Gesandte in Peking, Edmund Freiherr von Heyking, gekabelt; "Geld
und Kriegsschiffe" seien allein die Sprache, die China (und natürlich
alle anderen Mächte) verstünden.30
Von daher war es logisch, daß Kiautschou dem Reichsmarineamt zur
Verwaltung übertragen wurde - aber es war das gleiche Reichsmarineamt,
das dann nach dem Motto von Tirpitz verfuhr: "Hauptbedingung (für
Tsingtau) war mir die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit; eine
rein militärische Basis zu schaffen schien mir nicht geraten."31
Der Grund für diese Zurückhaltung lag im Schlachtflottenkonzept:
Da sämtliche Ressourcen des Reiches für den Schlachtflottenbau und
die - letztlich utopische - Entscheidungsschlacht in der Nordsee
gegen England benötigt wurden, blieb für den strategischen Auf-
und Ausbau Kiautschous nichts übrig, ja Tirpitz wandte sich in den
kommenden Jahren vehement gegen alle Pläne, das Ostasiatische Kreuzergeschwader
zu verstärken - solange der Flottenbau nicht beendet war. Daß der
Großadmiral nach Erreichen dieses Ziels sehr wohl an den zweiten
Schritt, die Projektion der deutschen Seemacht nach Ostasien, dachte,
steht allerdings fest. Wenn Tsingtau zur "Musterkolonie" wurde,
so war dies in seinen Augen nur das Präludium zum Muster-Flottenstützpunkt.
"Der Gedanke, uns einen starken Stützpunkt in Ostasien zu schaffen,
nach dem die Deutschen gravitieren konnten, war richtig; aber die
Vorbedingung war, daß wir uns mit Japan gutstellten."32
Mit dem Amtsantritt von Tirpitz als Staatssekretär im Reichsmarineamt
wurde Tsingtau zum Wechsel auf eine noch ferne Zukunft; was sich
demgegenüber seestrategisch und marinepolitisch zwischen 1897 und
1914 tat, gehorchte politischen und maritimen Augenblicksnotwendigkeiten,
trug zur Schürzung des weltpolitischen Knotens im Fernen Osten jedoch
erheblich bei.
Und dies vor allem auch in psychologischer Hinsicht, denn der Kaiser,
wie ein großer Teil der kolonialenthusiastischen Öffentlichkeit,
weckten nach 1898 den Anschein, als würde das Reich mit unbändiger
Kraft und "gepanzerter Faust" seinen Willen in Fernost allen anderen
Mächten oktroyieren. Vor allem die Vorgänge um das deutsche Engagement
während des "Boxer-Aufstandes" trugen entgegen aller "Weltmarschall"-Euphorie,
trotz Seymours "The Germans to the Front!", zur Eintrübung des deutsch-britischen,
vor allem aber auch des deutsch-japanischen und deutsch-russischen
Verhältnisses bei.33 Deutschland trat
in China mit 20000 Mann und 26 Schiffen als drittstärkste Seemacht34
auf und ließ etwas von den wahren Zielen der deutschen maritimen
Ostasienpolitik ahnen - aber das ganze Unternehmen, von den Sozialdemokraten
im Reichstag ob seiner verfassungspolitisch bedenklichen Konsequenzen
scharf verurteilt, war der reinste Anachronismus und mit 240 Millionen
Reichsmark teurer als der Kaiser-Wilhelm-Kanal.35
Der Euphorie folgte denn auch der Katzenjammer, seit 1901 wurde
die maritime Präsenz im Fernen Osten systematisch wieder abgebaut.
Das englisch-japanische Bündnis vom 30. Januar 1902, vom Auswärtigen
Amt völlig falsch interpretiert, entzog dann allen deutschen Flottenplänen
schon endgültig den Boden. Resignierend stellte der Admiralstab
fest: "Unter diesen Umständen bildet der genannte Hafen … im Falle
kriegerischer Verwicklungen keinen Stützpunkt für unsere in Ostasien
stationierten Land- und Seestreitkräfte. Das Kreuzergeschwader wird
sich bei Ausbruch eines Krieges in anderen Seegebieten zu basieren
suchen. Für die Vertheidigung von Kiautschou kommen die Schiffe
daher nicht in Betracht. Es muß damit gerechnet werden, daß die
Kolonie unmittelbar nach Kriegsausbruch von den überlegenen Flotten
unserer möglichen Gegner in Ostasien (Zweibund, Union, England,
Japan) genommen wird."36
Ein Vergleich der Flottenstärken37 ließ
Deutschland (und Österreich) in den ostasiatischen Gewässern auch
nicht den Hauch einer Chance; Tsingtau war eben ein Wechsel auf
eine ferne Zukunft gewesen, diese aber war dem Reich mit dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges radikal abgeschnitten. Hatten Tsingtau und
das Ostasiatische Kreuzergeschwader noch während der chinesischen
Revolution von 1911/12 eine nützliche Rolle spielen können, so blieb
ihm im August 1914 nichts übrig, als ohne jeglichen landstrategischen
Rückhalt gegen die britische Übermacht zu operieren. Sieg und Untergang
des Speeschen Geschwaders bei Coronel und den Falklands illustrierten
in dramatisch-tragischer Weise noch einmal die Möglichkeiten und
Grenzen des deutschen maritimen Übersee-Engagements.38
Der Fall der Festung Tsingtau am 7. November 191439
war ebenso unvermeidlich wie logisch, nachdem Politik und Strategie
es versäumt hatten, Kiautschou politisch und militärisch zu sichern.
Ersteres wäre nur möglich gewesen, wenn das Reich und nicht England
mit Japan verbündet gewesen wäre, letzteres, wenn Tirpitz auf das
Schlachtflottenkonzept verzichtet hätte. Ob dann die causa prima
des deutsch-britischen Gegensatzes entfallen und der Weltfriede
gerade deswegen ebenso erhalten geblieben wäre wie Tsingtau, bleibt
eine offene Frage.
|