        |
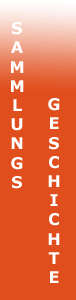 |
Klaus-Peter Merta
II. Zur Geschichte der Auszeichnungssammlung
im Zeughaus
Entstehung und Aufbau
 |
Abb.
1
Vitrine aus dem Zeughaus mit den Andenken an Kaiser Napoleon
I. Der Hut wurde 1957 durch die Sowjetunion zurückgegeben,
die Orden befinden sich noch im Staatlichen Historischen Museum,
Moskau. |
Mit der Unterschrift Kaiser Wilhelms I. am 17. März 1877 wurde
die Umwandlung des Zeughauses vom Arsenal und Waffenmagazin in eine
Ruhmeshalle mit Waffensammlung festgelegt und gesetzlich beschlossen.
Obwohl die Ruhmeshalle mit den beiden Feldherrenhallen noch im Bau
war, wurden die Ausstellungen 1883 der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Besichtigt werden konnten die umfangreiche Artilleriesammlung,
Waffen, Rüstungen, Fahnen sowie in geringem Maße Uniformen
und Ausrüstungsstücke. Zum Teil stammten die Gegenstände
aus den Kriegen des 18. und 19. Jahrhunderts, an denen preußische
Truppen beteiligt waren. Erobertes und erbeutetes Kriegsgut hatte
Trophäencharakter, es wurde in aufwendigen und imposant wirkenden
Raumgestaltungen zusammengefaßt. Aus dem Jahre 1880 heißt
es, die Ruhmeshalle hat "den Zweck, das Andenken an die Großthaten
der preußischen Armee auch bei den kommenden Geschlechtern
wach zu halten und zur lebendigen Anschauung zu bringen durch Sammlung
>der Trophäen Preußischen Kriegsruhmes und aller Gegenstände,
welche auf die Entwicklung des Brandenburgisch-Preußischen
Kriegswesens Bezug haben<"(Rep. Z 580,Bl.1/2). Für
den Besucher des Zeughauses sollten sich die Sammlungen über
drei Ausstellungsschwerpunkte erschließen, die nach den "Bestimmungen
betreffend die Ausstellung der Sammlungen im Zeughaus zu Berlin"
aus dem Jahr 1881 wie folgt abgefasst waren: "Die Zeughaus-Sammlung
zerfällt in 3 räumlich abgesonderte Teile. I. Die Entwicklungsgeschichte
der Hand- und Handfeuerwaffen, mit den Feldzeichen der brandenburgisch-preußischen
Armeen, und den erbeuteten Feldzeichen fremder Armeen, sowie den
Reliquien der Herrscher und berühmten Heerführer. II.
Das Artillerie-Museum. III. Das Ingenieur-Museum …"
 |
Abb.
2
Bildnis Kaiser Friedrichs III. in Generalsuniform mit angelegten
Orden, Öl auf Leinwand, um 1888 |
Daß entsprechend der Aufgabenstellung des Zeughauses den
Gegenständen aus den Nachlässen preußischer Könige
und Prinzen sowie bedeutender Feldherren besonderes Augenmerk gewidmet
wurde, läßt sich leicht vorstellen. So sollten die Andenken
an die Herrscher separat zusammengefaßt präsentiert werden.
Feldherrenreliquien fügten sich chronologisch in die Ausstellung
ein. Bis 1889 gab es überhaupt noch keine systematisch und
konzeptionell ausgerichtete Auszeichnungssammlung im Zeughaus. Lediglich
mit den 1883 aus der Königlichen Kunstkammer übergebenen
Andenken an Napoleon I. besaß das Zeughaus Orden von herausragender
Qualität (Abb. 1). Gemäß dem Vermächtnis Kaiser
Wilhelms I. gelangten am 16. Februar 1889 seine eigenen Auszeichnungen
sowie nach dessen Tode die seines Nachfolgers, Kaiser Friedrichs
III. (Rep. Z 514; Abb. 2), in das Zeughaus. Mit beiden personenbezogenen
Teilnachlässen lagen erstmalig etwas umfangreichere Auszeichnungsgruppen
vor. Wenn auch die Schaffung eines solchen Bestandes bisher nicht
zu den Themen der Sammlungen zählte, so faßte der von
1879 bis 1897 fungierende Kommandant des Zeughauses, Oberst Julius
Ising, doch bereits im Jahr 1885 den systematischen Aufbau einer
deutschen Ehrenzeichensammlung ins Auge.
Die Stärken des 1895 zum Generalleutnant beförderten
und ein Jahr darauf geadelten Ising lagen vornehmlich auf artilleristischem
Gebiet. In seiner langjährigen Tätigkeit stellte er wiederholt
seine fachwissenschaftliche Kompetenz sowie Kunst und Kultursachverstand
unter Beweis. Als 1885 ein Mann namens August Hoch der Zeughaus-Verwaltung
210 "Militair Decorationen vom Feldwebel abwärts der Vergangenheit
und Gegenwart in original Exemplaren, mit dem betreffenden Bande
..." zum Kauf anbot, griff Ising sofort zu und formulierte
einen Erwerbsantrag bei der für das Zeughaus zu ständigen
übergeordneten Dienststelle. Durch zwei in den Jahren 1887
und 1888 ausgesprochene Ablehnungen des Allgemeinen Kriegsdepartements
ließ sich Generalmajor Ising nicht entmutigen, und in Kenntnis
der Langwierigkeit preußischer Dienstwege wiederholte er 1889
den begründeten Antrag. Der 1885 gefaßte Entschluß
Isings führte dank der Beharrlichkeit des über vier Jahre
geführten Kampfes schließlich nach Genehmigung des Kriegsministers
zum Erfolg. Von August Hoch erwarb das Zeughaus 321 Militärauszeichnungen
aus 36 deutschen Territorien für den Preis von etwas über
4.000 Reichsmark (Rep. Z 643).
Anfang 1890 konnten die Besucher die in Glasvitrinen geordneten
Ehrenzeichen im oberen Stockwerk des Zeughauses besichtigen. Mit
diesem Ankauf hatte Ising den Ausgangspunkt für den Aufbau
eines Auszeichnungsbestandes als eigenständige und übergreifende
Teilsammlung im Zeughaus gelegt. Nicht die Orden, deren Zugang über
die Herrscherreliquien und Feldherrenandenken ohnehin zu erwarten
war, sollten die Grundlage für eine Auszeichnungssammlung bilden,
sondern Ehrenzeichen für Kriegsverdienste, militärische
Denkmünzen und Erinnerungszeichen sowie Treueauszeichnungen.
Eine Ausstellung von Auszeichnungen für den "kleinen Mann"
entsprach am ehesten den Aufgaben von Zeughaus und Ruhmeshalle.
Ihre Stiftung war immer aus militärischem oder kriegerischem
Anlaß erfolgt, und die Verleihung war an ein konkretes militärisches
Verdienst gebunden. Belegt die schnellstmögliche Zurschaustellung
aller erworbenen Auszeichnungen einerseits ihre Bedeutung für
die propagandistischen Ziele des Zeughauses, so ließ andererseits
die Nutzung als Forschungsobjekt nicht lange auf sich warten.
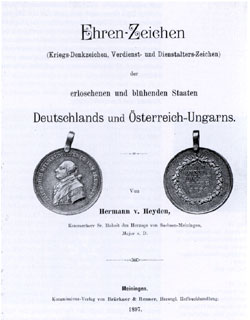 |
Abb.
3
Titelseite des Werkes "Ehren-Zeichen (Kriegs-Denkzeichen,
Verdienst- und Dienstalters-Zeichen) der erloschenen und blühenden
Staaten Deutschlands und Österreich-Ungarns" von Hermann
von Heyden, Meiningen 1897 |
Der wohl als Begründer der modernen Ehrenzeichenkunde zu bezeichnende
Hermann von Heyden (1840-1917) nutzte für Forschungs- und Studienzwecke
diesen Auszeichnungsbestand. Einen Niederschlag fand das vor allem
in der von ihm verfaßten, auch heute noch zu den Standard-
und Grundlagenwerken der Faleristik zählenden Publikation "Ehren-Zeichen
... Deutschlands und Österreich-Ungarns" (Abb. 3). Auch
wandte er sich 1892 an das Zeughaus mit der Bitte um Tauschmöglichkeiten
sowie Vermittlung von Nachbildungen. Bereits zu diesem Zeitpunkt
gab es Ehrenzeichen, die nicht mehr oder nur schwer zu beschaffen
waren. Deshalb legte wohl auch der Verkäufer August Hoch Wert
darauf, daß es sich bei dem 1885 unterbreiteten Angebot an
das Zeughaus um "original Exemplare" handelte. Selten
waren vor allem Medaillen und Kreuze aus der Entstehungszeit von
Ehrenzeichen. Sie waren sparsam verliehen worden, und nach dem Tode
der Beliehenen setzten die meist nicht begüterten Nachfahren
den Edelmetallwert der Stücke um. So ließ das Zeughaus
das preußische Goldene Militär-Ehrenzeichen von 1806,
das in einem Exemplar noch bei der Generalordenskommission lag,
durch die Juwelier-Firma Sy & Wagner nachbilden. Solch ein Galvano
vermittelte dann das Zeughaus auch für die Sammlung von Heydens.20
Dagegen lag das vom Zeughaus gewünschte Militär-Ehrenzeichen
von 1814 bei der Ordenskommission schon nicht mehr im Original vor.
Auch dieser Umstand verdeutlicht die Richtigkeit von Isings Beharren
auf einer Ehrenzeichensammlung, um Stücke für die Nachwelt
zu sichern. Was die Auszeichnungen im Zeughaus anbelangt, so markierten
sich zwischen 1889 und 1897 bereits zwei Schwerpunkte. Zum einen
ergab sich dank den von Ising erworbenen militärischen Ehrenzeichen
die Möglichkeit, durch kontinuierliches Sammeln weitgehende
Vollzähligkeit für alle deutschen Staaten anzustreben.
Andererseits gelangten hochwertige Orden personengebundener Provenienz
ins Zeughaus, wodurch eine Ordenssammlung begründet werden
konnte.
|
   |
|
