|
Streiks im 18. Jahrhundert?
Der Terminus "Strike" setzte sich seit den fünfziger und sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland durch, nachdem er in England
rund 100 Jahre zuvor zuerst aufgetaucht war - wenngleich kollektive
Arbeitsniederlegungen auch hier schon mindestens ein Jahrhundert früher
stattfanden. Auf dem Kontinent gab es bereits seit dem späten Mittelalter
kollektive Arbeitsniederlegungen, etwa 1351 in Speyer, als Tuchweberknechte
"von des lones wegen" in den Ausstand traten. Solche Konflikte waren
keineswegs nur auf das Gewerbe beschränkt, denn auch im Bergbau kam es in
der frühen Neuzeit zu Arbeitseinstellungen.
Können wir nun diese Konflikte, die häufig auch "Aufstand",
"Aufruhr" oder "Unruhe" genannt wurden, als Streik bezeichnen?
Wenn heute unter Streik die befristete Arbeitsniederlegung abhängiger
Produzenten als Ausdruck einer Beschwerde oder zur Verstärkung einer
Forderung verstanden wird, so scheint die Verwendung des Begriffes von
der Form her durchaus naheliegend. Doch welche Mittel wurden gewählt,
welche Ursachen lagen den Streiks zugrunde, und welche Forderungen wurden
gestellt? Unterscheiden sich die Gesellenstreiks des 18. Jahrhunderts nicht
deutlich von den Arbeitsniederlegungen der Industriegesellschaft?
Im 18. Jahrhundert war der Streik als Mittel des Arbeitskampfes im Handwerk -
und dann auch in der Manufaktur - besonders in Gewerbestädten wie Nürnberg
oder Augsburg durchaus keine Seltenheit. Für die deutschen Städte dieser
Zeit sind allein mehr als 500, in England von 1717 bis 1800 fast 400 solcher
Fälle bekannt.
Diese Arbeitsniederlegungen verliefen keineswegs gewalthaft, wie vielfach
angenommen wurde, und es handelte sich dabei auch nicht um
spontan-emotionalen Protest: Die Aktionen der Gesellen waren in der Regel
gut vorbereitet und organisiert. Zu Gewalt kam es meist erst nach dem
Eingreifen der Obrigkeit, wenn z. B. die Herberge vom Militär oder von der
Stadtwache umstellt wurde oder man Gesellen verhaftete, wie beim
"Breslauer Gesellenaufstand" von 1793. Die Gesellen suchten ihre
Forderungen nach Möglichkeit in Phasen erhöhter Nachfrage durchzusetzen,
sei es vor den Feiertagen, vor der Messe oder ansonsten bei hohem Bedarf
an Arbeitskräften. Für die Organisation dieser Aktionen kam ihnen ihre
Herbergskultur zugute. Auf der Herberge trafen sich die Gesellen regelmäßig
zur "Auflage" oder zum "Gebot", und hierher zogen sie sich
zur Beratung zurück. Die Arbeitsniederlegung wurde meist während einer
Versammlung auf der Herberge bei offener Gesellenlade beschlossen, und oft
entsandte die Obrigkeit - informiert durch die Meister - dann den
Gerichtsdiener, der die Gesellen aufforderte, wieder an die Arbeit zu gehen
und die Forderungen bzw. Klagen vor Gericht vorzubringen. In den größeren
Gewerbestädten wurde danach vielfach vor den jeweiligen Handwerks- oder
Gewerbegerichten oder einer Ratsdeputation verhandelt, in Nürnberg zum
Beispiel vor dem "Rugsamt" oder in Bremen vor den
"Morgensprachsherren".
Nicht zuletzt die Haltung der Obrigkeit bestimmte den weiteren Verlauf.
Eskalierende Konflikte waren häufig von Umzügen der Gesellen durch die
Stadt begleitet. Dort wo die Gesellen militärisches Eingreifen befürchteten,
zogen sie in umliegende Dörfer oder Städte ab, zum Beispiel von Augsburg
ins kurbayerische Friedberg, von Nürnberg nach Fürth und von Frankfurt am
Main nach Offenbach. Durch die Mitnahme der Ladenschlüssel oder gar der
Lade selbst wurde die Stadt "geschimpft". "Laufbriefe", die
von wandernden Gesellen von Herberge zu Herberge transportiert wurden,
erreichten in kürzester Zeit die Gesellenschaften des ganzen Reiches und
bewirkten einen Boykott oder erbrachten finanzielle Unterstützung. Beim
"Aufstand" der Augsburger Schuhknechte 1726 korrespondierten die
Gesellen - wie an den abgefangenen Laufbriefen zu erkennen ist - nicht nur
mit den Gesellenschaften in Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Mainz
und Heidelberg, sondern unter anderem auch mit Leipzig, Dresden, Berlin,
Halle, Magdeburg, Braunschweig und Hannover, so daß die Meister befürchten
mußten, der Boykott werde "unseren totalruin gar gewiß generieren".
Streiks konnten also von einigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen dauern.
Die Bremer Schuhmachergesellen legten 1736 drei Monate lang die Arbeit
nieder, und die Augsburger "Schuhknechte" brachten es 1726 immerhin auf 14
Wochen. Dominant waren jedoch die kurzen Streiks, die ein bis zwei Tage
dauerten und an denen sich die Gesellen eines Handwerks beteiligten. Zur
Solidarisierung verschiedener Gesellenschaften kam es insbesondere, wenn
ihre kooperative Autonomie bedroht war. Solche Konflikte konnten dann auch
zu einem "Generalstreik" eskalieren. Von besonderer Intensität waren
zum Beispiel der Streik der Hamburger Schlossergesellen 1791, der sich zu
einem solchen Generalstreik ausweitete, oder auch der Streik der Breslauer
Schneidergesellen 1793, dem sich die Tischler-, Schlosser- und Zimmergesellen
anschlossen, und schließlich der von den Münchner Schlossergesellen 1796
ausgelöste Generalstreik. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam es mehrfach
zu gewerbeübergreifenden Aktionen, wobei hier weniger jakobinische Einflüsse
zu vermuten sind als zunehmend obrigkeitliche Eingriffe in die Autonomie
der Gesellenschaften bis hin zur Auflösung der Gesellenladen.
|
|

Unterschriftentondo streikender Bergleute in Clausthal, 1738.
[größeres Bild]
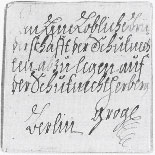
Brief an die Bruderschaft der Schuhknechte in Berlin, 1726.
[größeres Bild]
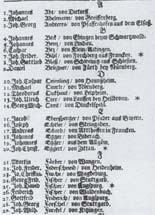
Fahndungsliste des Augsburger Magistrats, 1726.
[größeres Bild]

Kaiserliches Dekret, 1726.
[größeres Bild] |
