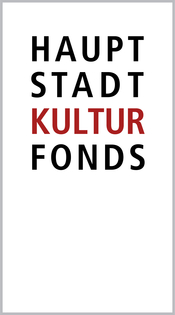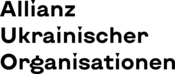Kyjiw, Berlin, Hollywood
Die vielen Gesichter von Anna Sten

„Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad Dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub’, ich gehöre nur mir ganz allein.“ Dieses von Friedrich Hollaender und Robert Liebmann für sie geschriebene Lied singt Anna Sten auf dem Höhepunkt ihres letzten deutschen Films Stürme der Leidenschaft (1932).
Wenig später reist sie ab nach Amerika, wo sie der Produzent Samuel Goldwyn zum Weltstar machen will: die erste Schauspielerin aus der Sowjetunion, die in Hollywood groß herauskommt! Man versucht sie nach dem Vorbild der beiden anderen europäischen Diven Greta Garbo und Marlene Dietrich zu modellieren und bringt ihr bei, wie sich ein Star in der Öffentlichkeit zu benehmen hat. In Anna Sten, der die Manierismen und das Gehabe der Stars völlig fremd sind, regt sich Widerwillen. Der New York Times sagt sie 1934: „I am an actress. I came here to work, to study. Not to give a monkey exhibition!“
Wie zuvor in Deutschland wurde Anna Sten auch in Amerika als Russin vermarktet und auf der Leinwand als „Exotin“ inszeniert, als Ausländerin, als Fremde. Dass sie gebürtige Ukrainerin war, ging im Prozess der Exotisierung und der auch im Westen betriebenen Russifizierung fast immer unter.
Geboren 1904 in Kyjiw als Anna (Hanna) Fisakova, wächst Sten in einer Zeit auf, in der das Zarenreich die ukrainische Sprache, Kultur und jegliches Unabhängigkeitsstreben unterdrückt und der Schulunterricht nur in russischer Sprache stattfindet. Während sich ihr Vater als Lehrer für Volkstänze betätigt und so seine Verbundenheit mit der ukrainischen Kultur unter Beweis stellt, macht die Schule Sten mit dem normativen russischen kulturellen Kanon vertraut. Nicht nur im Fall ihrer Familie rief der Zustand der Kolonialität widersprüchlich scheinende, an Selbstverleugnung grenzende Verhaltensweisen hervor.
Im post-revolutionären Kyjiw – der Hauptstadt der Ukrainischen Sowjetrepublik – absolviert Sten in den 1920er Jahren ihre künstlerische Ausbildung und arbeitet bei einer Tageszeitung, die in russischer und dann im Zuge einer zeitweise gelockerten Nationalitätenpolitik in ukrainischer Sprache erscheint. In der Ukraine entsteht 1926 auch ihr erster Film, Provokator. Auf der Suche nach neuen künstlerischen Herausforderungen geht sie anschließend nach Moskau, das Zentrum der sowjetischen Kulturproduktion. Dort sorgt sie 1927 für Aufsehen in der Hauptrolle in Dewuschka s korobkoi (Das Mädchen mit der Hutschachtel, 1927), einem Film des als „Rote Traumfabrik“ geliebten und geächteten Meschrabpom-Studios. In kürzester Zeit entwickelt sich Anna Sten zu einem der populärsten Stars des sowjetischen Kinos und zum Gesicht eines Neuaufbruchs.
Der Erfolg ihrer Filme im Ausland ebnet Sten 1929 den Weg nach Berlin, wo sie eine überaus produktive Zeit verbringt. Bereits ihr erster Tonfilm, Der Mörder Dimitri Karamasoff (1931), trägt ihr einen Hollywood-Vertrag ein, doch glücklich wird Anna Sten im amerikanischen Studiosystem, das ihre Schauspielerpersönlichkeit einengt, nicht. Ihre drei großen Filme für Samuel Goldwyn erfüllen die hohen kommerziellen Erwartungen nicht. Sten gilt fortan – heute unverständlich – als Kassengift und spielt daher zunächst nur in den unabhängig hergestellten Filmen, die ihr Ehemann Eugene Frenke produziert oder inszeniert. Ihre Rollen werden kleiner, sind dafür aber vielfältiger und unterlaufen die eingeübten Stereotype. Es sind Anti-Nazi-Filme, Filme über Emigranten und Heimatlose, düstere, nächtliche Geschichten über Verfolgung und Entwurzelung. Noch bis 1964 tritt Anna Sten, die längst amerikanische Staatsbürgerin ist, in meist kleineren Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen auf. Daneben spielt sie Theater und führt ein Leben außerhalb des Showbusiness. Sie stirbt 1993 in New York.
Als Anna Sten in den 1930er Jahren mit ihrem polnisch-jüdischen Ehemann und ihrer Tochter in Kalifornien lebt und eine Rückkehr in ihr vom stalinistischen Terror und dem Holodomor gezeichnetes Heimatland ebenso unmöglich ist wie ins faschistische Deutschland, erscheint in einer ukrainischen Zeitung in den USA ein Interview mit ihr unter dem Titel: „Is Anna Sten A Ukrainian? What Does the Great Actress Say About Herself?“ Darin sagt sie klar und deutlich: „Most certainly I am Ukrainian. (…) I was born in Ukraine.“ (Ukrainian Weekly, 24.12.1937)
Die Filme, denen Anna Sten durch ihre Präsenz und ihr Spiel ihren Stempel aufdrückt, entstanden in der Ukraine und Russland, als dies zwei Sowjetrepubliken waren, in Deutschland, Großbritannien und den USA. Sie gehören zum nationalen Filmerbe all dieser Staaten und darüber hinaus zu einem Filmerbe, das keine Nationalität hat, sondern denen gehört, in deren Erinnerung diese Filme aufbewahrt sind und eine imaginäre Heimat besitzen. Dagegen gehörte die Künstlerin Anna Sten – wie sie in Stürme der Leidenschaft singt – niemandem, sondern nur sich selbst. (Philipp Stiasny)
Die Retrospektive wird vom Hauptstadtkulturfonds gefördert. Kurator der Reihe ist Philipp Stiasny. Kuratorin des Podiumsgesprächs ist Oleksandra Bienert vom CineMova Ukrainian Empowement Network e.V. Unser besonderer Dank gilt den Anna Sten-Experten Ivan Kozlenko (Cambridge) und Peter Bagrov (Rochester), ohne deren Hilfe, Fachwissen und Enthusiasmus diese Retrospektive nicht stattfinden könnte.
An anderen Orten
Weitere Veranstaltungen der Retrospektive Kyjiw, Berlin, Hollywood. Die vielen Gesichter von Anna Sten finden in Berlin im BrotfabrikKino und im Bundesplatz-Kino statt. Der Mörder Dimitri Karamasoff ist zu sehen am 26. Oktober um 16 Uhr im BrotfabrikKino (Einführung: Oleksandra Bienert) und am 9. November um 11 Uhr im Bundesplatz-Kino (Einführung: Philipp Stiasny). Der Zirkusfilm Salto mortale läuft am 2. November um 11 Uhr im Bundesplatz-Kino (Einführung: Frederik Lang). Den Stummfilm Lohnbuchhalter Kremke begleiten der Pianist David Schwarz und die Perkussionistin Maren Kessler am 16. November um 16 Uhr im BrotfabrikKino (Einführung: Philipp Stiasny). Kartenreservierungen nehmen das BrotfabrikKino und das Bundesplatz-Kino gerne entgegen.